Schwimmen (siehe auch neuer Trainingsplan)
Zum Schwimmen bin ich erst im Alter von 36 Jahren aufgrund wiederkehrender Rückenprobleme gekommen.
Zunächst schwamm ich regelmäßig einmal pro Woche. Kraulen konnte ich gar nicht.
Als Kind war ich im Grundschulalter mehrmals täglich im Sommer vom "5er" gehopst,
auch Saltos vom 1-m-Brett oder vom Startblock waren mir willkommen.
Allerdings beschäftigte ich mich danach eher mit Leichtathletik, Laufen und Springen an Land.
Heute weiß ich, dass Schwimmen mein Sport ist! Rückenprobleme traten nie wieder auf!
Das Kraulen habe ich mir selbst vor ca. 1,75 Jahren in einem Nichtschwimmerbecken beigebracht.
Bis dato dachte ich, ich könnte gar nicht kraulen. Eine Sportlehrerin, die in einem Freibad
für ihre SchülerInnen den Kraulstil anschaulich demonstrierte, der auch ich zusah,
motivierte mich. Da die Lehrerin es so gut vormachen konnte, hatte ich eine Anleitung gefunden.
Zunächst konnte ich mangels Kraft, ausgefeilter Technik und Luft nur ca. 15 m kraulen.
Dennoch schwamm ich auf kurzen Strecken mit einem Freund um die Wette. Oh, Wunder,
wir waren gleich schnell!
Aus Interesse und angeregt durch eine Freundin sowie aus beruflichen Gründen wagte ich es,
1 Jahr nach meinen ersten Kraulversuchen einen freundlichen Herrn von der DLRG nach dem Silbernen
Rettungsschwimmabzeichen zu fragen (Ich wollte ja nur "fragen"!) - ich konnte nicht ahnen, dass
der Herr sofort seine Stoppuhr aus der Tasche zog und mich auf den Startblock befehligte.
Oh, Wunder, ich tauchte nach kurzer Info von "Heiko" auf Anhieb 28 m Strecke.
Dann absolvierte ich am gleichen Abend noch die 400 m sowie einen Transportierteil. Keuchend
brachte ich die darin enthaltenen 50 m Kraulen hinter mich. Das hatte ich gerade eben geschafft!
Vom "3er" bin ich nach all den Jahren auch mal wieder gesprungen, frei nach dem Motto
"runter kommt man immer!" und "Augen zu und durch!". Eine liebe Freundin meiner Mutter stand derweil
am Beckenrand und drückte mir die Daumen. Meinen Sprung vom 3-m-Brett hatte sie allerdings nicht gesehen!
Es folgten noch weitere Prüfungen und schließlich bestand ich die letzte,
welche eine theoretische war, unter der kritischen Begutachtung von einem der drei Einsatztaucher des Bezirks
Oberelbe und von einem Beisitzer am 02.10.2005 in einem kleinen Häuschen der DLRG an der Elbe.
Ich glaube, zuletzt war ich so stolz gewesen, als ich zum ersten Mal in die Schule kam!
Und nun kehrte dieses Gefühl von damals zurück, mit 39 Jahren erwischte es mich erneut!
"Heiko" wollte noch die Einwilligung meiner Erziehungsberechtigten einholen, bis ihm wohl klar wurde,
dass seine Sehschärfe ihn im Stich gelassen hatte. Nicht jede Anwärterin für das "Silberne"
ist unter 18 - vielleicht dokumentierte diese Fehleinschätzung seine Urlaubsbedürftigkeit.
Jedenfalls fehlte Heiko sodann für 6 Wochen nach meiner ersten Prüfung. Matthias übernahm
darauf das Prüfen.
Nachdem ich dann zum ersten Mal in meinem Leben einen Schwimmpass mit Eintrag des "DRSA Silber"
erhalten hatte (Dagmar, meine Übungspartnerin von der DLRG, sagte mir, dass ich meinen "Pass" abgeben
müsse. Ich antwortete darauf erstaunt: "Meinen Personalausweis???!". Sie, auch erstaunt: "Nein,
Deinen Schwimmpass! Hast Du etwa gar keinen?", fragte sie mich mit weit aufgerissenen Augen,
während wir nebeneinander herschwammen.
Ich fühlte mich irgendwie schuldig, da ich tatsächlich keinen hatte. Auch geriet ich rasch ins
Grübeln, ob ich da etwas nicht mitbekommen hätte wie etwaige Passkontrollen beim Schwimmen???!
Dagmar beruhigte mich, dass das auch nichts ausmachen würde und mir dann halt ein ganz neuer
Schwimmpass ausgestellt werden würde. Ich atmete auf, jetzt habe ich natürlich einen und kann
mich zur Not ausweisen! Nicht mehr passlos unterwegs zu sein, beruhigt die Nerven doch enorm!),
übertrieb ich es mit dem Schwimmen etwas - man muss nicht jeden Tag bald 3 Stunden im Wasser zubringen,
ob Sommer, ob Winter - und kämpfe mittlerweile gegen eine leichte Chlorunverträglichkeit.
Dennoch bleibt es mein Sport!
Als frisch gebackene Rettungsschwimmerin hatte ich schon einen Einsatz.
Ansonsten schleppe oder ziehe ich gern Leute hin und her, wenn sie vorher selbstredend einwilligten
und übe am liebsten Befreiungsgriffe. Leider erklären sich dazu nur wenige Leute bereit!
Stolz bin ich nicht nur auf meinen ersten Einsatz, sondern auch darauf, dass ich seit meinen ersten
Kraulversuchen inzwischen mehrere hundert Meter Kraulen kann und das in einer ganz guten Zeit, nämlich
600 m in 10 Minuten, wenn ich in guter Form bin. Alles ohne professionelle Schulung!
Geholfen mit Kritik an meinem Kraulstil haben mir jedoch Wolfgang aus der Lessinghalle zu Kiel
(Wer kennt Wolfgang nicht?!) und eine Dame, die ich leider nur kurz in einem Freibad kennenlernte.
Sie trainiert u. a. Schwimmer und Schwimmerinnen für die Paralympics. Sie schwamm ein paar Bahnen
neben mir her und beobachtete meinen Beinschlag. Sie erzählte, dass sie schon über 60 Jahre alt sei,
was man ihr bei weitem nicht ansah!
Eine tolle Frau lernte ich noch im Schwimmbad kennen, die leider in Thüringen lebt. Ricarda! Sie ist 19 Jahre alt,
sensibel und klug sowie sprachlich ungeheuer begabt und Kampfsportlerin! Ich danke ihr, dass sie sich spontan bereit
erklärte, sich mit dem Seemannsfesselschleppgriff von mir schleppen zu lassen. Außerdem wünsche ich ihr
einen guten Job oder ein Studium, das sie zusätzlich zu ihrer Ausbildung zur UTA weiterbringt!
Soviel erst einmal zu meinem Lieblingssport!
22.04.2006, Maren Rehder
Da es sich um meinen Lieblingssport handelt, könnte ich über das Schwimmen andauernd schreiben.
Besonders das Kraulen hat es mir angetan. Es ist eine perfekte, ganzheitliche und organische Fortbewegungsart, die mich
mit dem Element Wasser ganz und gar eins sein lässt. Ich würde mich am liebsten nur so fortbewegen (müsste dann
aber wohl Kiemen haben).
Da mir meine Trainingspartnerin Ricarda leider abhanden kam, musste ich das von mir geliebte Rettungsschwimmen
etwas zurückstellen. Im nächsten Jahr plane ich, eine Auffrischungsprüfung zu machen, auf die ich mich
schon sehr freue. Mit Verabredungen im Schwimmbad ist es nach meiner Erfahrung nicht ganz leicht, mal klappt´s, mal nicht.
Kurzerhand habe ich in diesem Jahr einen 8-wöchigen Trainingskurs nach Vorschlägen von Sandra Völker in Eigenregie
bis auf den letzten Trainingstag (Unwetter im Schwimmbad verursachte ein längeres, krankheitsbedingtes Pausieren) absolviert.
Entscheidend war der Weg zum Ziel 1500 m Kraul - die 1500 m habe ich tatsächlich locker geschafft (= 30 Bahnen
x 50 m + Ein- und Ausschwimmen), nur beinhaltet ein gutes Training gesundheitliche Aspekte. Also, man sollte die Leistung
stufenweise anziehen, nach einer großen Anstrengung mindestens einen Tag Pause machen und nicht jeden Tag "Marathonstrecken"
schwimmen, wenn sich der Körper daran noch nicht gewöhnt hat. Ich habe 3 x pro Woche trainiert. Wenngleich ich die
lange Strecke im Stück durchschwamm, hatte ich an den anderen Tagen eine Mischung aus kurzen, schnellen Strecken mit
mittelschnellen und langsamen Strecken - auch hier steigerten sich die Distanzen. Diese intensiven Kurzbahnen erforderten je-
weils an ihrem Ende eine genau abgezählte Pause, die sich im Laufe der Wochen verkürzte. Diese gestaffelten Pausen haben
den Sinn der Erholung des Schultergürtels sowie der allmählichen Steigerung anaerober Phasen. Außerdem ist es ratsam,
einseitige Bewegungen mit Gegenbewegungen wieder zu kompensieren.
Lange Brustkraulstrecken kompensiere ich z. B. mit Rückenkraulstrecken und wechsele zwischen einfachem Brustschwimmen
und Brustkraulen. Auf langen Brustkraulstrecken soll sich das Atmen nach je 2 Armschlägen bewährt haben.
Um auch hier Einseitigkeit zu vermeiden, atme ich meistens nach 3 Armschlägen und atme mit Kopfdrehung nach rechts und nach
links im Wechsel ein und unter Wasser aus. Die längere Beschäftigung mit diesem Sport hat mir gezeigt, dass es sehr
wichtige Details gibt, die ich früher nie wahrnahm - Schwimmen war einfach nur "Schwimmen" - im Grunde ist das nicht so
leicht, wie es oberflächlich scheint - auch das Schwimmen will richtig gelernt sein!
Nach meiner Krankheit stieg ich intuitiv bei 1000 m wieder ein. Jetzt möchte ich an das alte Training anknüpfen und
mir danach einen weiteren Plan (s. o.) für die Winterzeit erstellen.
Eine Karriere im Schwimmsport habe ich nicht mehr zu erwarten - es macht mir einfach Spaß!
Schwimmen ist für mich die umfassende Philosophie. Yoga reicht nach meinem Geschmack in etwa da heran.
Natürlich habe ich auch in diesem Jahr wieder ein paar Leute im Schwimmbad kennengelernt.
Einer Extrem-Schwimmerin schickte ich ein Paar Schwimmpaddles, weil es diese in HH scheinbar nicht gab.
Geehrt bin ich, weil ich meistens für einen Profi gehalten werde. So bat mich neulich flehentlich eine schon etwas betagtere
Triathletin, ob ich wohl die Hälfte meiner Bahn an sie abgeben würde. Selbstverständlich tue ich das - es ist ja gar
nicht "meine Bahn". Ihr Mann, der auch Triathlet war, hatte ohnehin gleich das Weite gesucht.
Die Chlorunverträglichkeit konnte ich mit einer Nasenklemme bekämpfen.
"Hätte", "könnte", "würde" ist aber nicht. Die Sportlehrer haben bei mir eine Nähe zum Schwimmsport
auf der Basis meines Körperbaus nie festgestellt. In der Oberstufe hatte ich wegen des Kurssystems nur noch ganz schlechte
Sportnoten, die zum Teil unter den Mindestanforderungen für anrechenbare Kurse lagen. Plötzlich sollte ich Basketball
spielen, weil die anderen Kurse alle belegt waren. Die Vereinsleute sahnten da ab, ganz klar! Absolut "in den Keller" ging die Note
allerdings durch meine Kursteilnahme im Jazzdance - damit lagen meine Leistungen in der Oberstufe bei einer 4-.
Leider konnte ich damals noch nicht differenzieren, dass Jazzdance eventuell nicht die wichtigste sportliche Disziplin ist.
Die meisten Schwimmbegeisterten glauben nicht, dass ich erst seit Oktober 2005 regelmäßiger schwimme bzw. kraule.
Ich staunte nicht schlecht, als ich neulich erfuhr, dass mein Vater, der eigentlich in jungen Jahren Leistungsturner war,
vollkommen untrainiert im Alter von Mitte Vierzig auf Anhieb über 50 m die DSV-Bedingungen mehr als erfüllte und bei einem
Volksschwimmen die Bronzemedaille erwarb. Das ist schon eine Leistung!
Ich habe eben erst spät mit dem Schwimmen angefangen und liebe es dennoch! Nur vom Delphinschwimmen rate ich ab, da es sich
ungesund auf die Lendenwirbelsäule auswirken könnte*. Ansonsten gibt es noch jede Menge anderen Sport - aber das Kraul-
schwimmen ist unter den "Top 10".
02.09.2006, Maren Rehder (- ergänzt am 22.04.2010 -)
* Uno momento: Also, wenn das Delphinschwimmen als sehr schwierige Disziplin mit seiner Wellenbewegung, die durch den ganzen Körper
geht, richtig beherrscht wird, wirkt es sich doch eher wohltuend auf die Wirbelsäule aus, da auch Wirbelpartien erfasst werden,
die sonst kaum erreicht werden können. Aber bis dahin ist es zumindest für mich ein anstrengender Weg.
19.04.2010, Maren Rehder
SCHWIMMEN ist eigentlich ALLES! Na ja, eine 4 + in meinem besten Sportkurs im Abitur ermutigte mich nicht gerade, meine Berufswahl
auf diesem Gebiet zu treffen (wenngleich ich bis zur 10. Klasse meistens sehr gute oder gute Noten in Sport hatte). Wie insbesondere
SportlerInnen mit Sieg und Niederlage umgehen, finde ich imponierend! Die Spitzen-Leute überschätzen sich nicht, und es wird
ihnen nach einer Niederlage in der Regel Zeit gegeben, die Form wieder aufzubauen und einen neuen Versuch unter dem Wohlwollen
des Publikums und der BetreuerInnen zu starten. Siege tragen die meisten Athleten realistisch bzw. für den Moment mit Freude,
aber letztendlich bescheiden.
Wenn ich in Süddeutschland aufgewachsen wäre, hätte ich mich gern auch mit dem Skilanglauf und dem Biathlon befasst.
Mit meiner besten Freundin aus der Kindheit, die gleich in der Nachbarschaft wohnte und die auch sportlich war, wetteiferte ich -
hin und wieder verhauten wir Jungs - manchmal wurde das zum Bumerang. Meistens stammten die Ideen für die Spiele von mir, die
Elke dann gewann. Hausverbot erhielt ich, weil wir - hinter dem Schutz einer Hecke sitzend - einen Mann mit eingeweichten Pflaumen
beschmissen hatten, was anscheinend auch meine Idee war. Dieser lahm wirkende ältere Herr war jedoch beweglicher, als wir vermuteten,
riss flugs sein schweres schwarzes Rad herum und verfolgte uns bis auf den Hof einer Freundin. Leider erwischte er nur ihre kleine Schwester
in den Tannen, während wir anderen über den Jägerzaun entkommen konnten. Das hatte berechtigte Folgen für mich!
Heute mache ich so etwas nicht mehr! Meine Mutter musste sich also nicht viel um uns kümmern, weil wir uns selbst beschäftigten.
Eine staatliche Betreuung war überflüssig. Dieses rief hin und wieder das Staunen der anderen Nachbarn hervor, die zu
meiner Mutter häufig sagten, wie "schön" wir spielen könnten.
In der Schule gewann ich schon mal eine Tafel Schokolade im Weitsprung von der Lehrerin oder lief eine Urkunde auf der Mittelstrecke
ein. Erst die Spezialisierung in den Oberstufenkursen machte mir das sportliche Leben schwerer!
Letztlich fasste ich erst wieder mit ca. 28 J. den Mut - hervorgerufen durch einen längeren Krankenhausaufenthalt aufgrund einer
sehr großen, entzündeten Zyste an der Milz (die Milz habe ich noch - die Zyste nicht mehr) und durch einen Vergleich mit
einer Sportstudentin - allmählich wieder etwas für die Kondition zu tun, die durch den Krankenhausaufenthalt stark be-
einträchtigt worden war. Inzwischen ersetze ich regelmäßiges Joggen durch Ausdauerschwimmen u. a.
Ich hoffe, dass ich diesen Hobbys noch lange werde nachgehen können!
Mir fiel ein, dass ich in diesem Jahr die Rettungsschwimmprüfung gar nicht zu absolvieren habe und entschied mich - bewaffnet
mit einer Thermoskanne Tee - an einem eiskalten Januarmorgen das DSV-Abzeichen Gold für Erwachsene in Angriff zu nehmen.
Es ist ein sehr vielfältiges Schwimmabzeichen, daher interessierte ich mich dafür.
Glücklichen Umständen, einer freundlichen Prüferin und einem freundlichen Prüfer sowie meiner Vorbereitung
verdankte ich, dass ich die ganze Prüfung in der Zeit von 8.15 bis ca. 9.00 Uhr hinter mich brachte und bestand.
Für eine Schwimmerin, deren Training nur ca. ein Zehntel von dem eines jungen Leistungsschwimmers umfassst, ist es nicht
ganz leicht, die 100 m unter 2 Minuten auf einer 25 m-Bahn zu schwimmen. Ich hatte jedoch den festen Entschluss, weiter
zu schwimmen, selbst wenn die Arme nicht mehr wollten. So kam ich dann auf 1:56 Minuten, bin im Training die Strecke je-
doch auch schon in 1:51 Minuten geschwommen. Startsprünge müsste ich noch verfeinern, dafür sind mir schon
einige Rollwenden im Rückenkraulen gelungen. Seltsamerweise halte ich die mühsam erschwommene Zeit auf der Kurz-
strecke leichter auf längeren Strecken - jedenfalls sackt die Leistung dann nicht auf 3 Minuten pro 100 m, sondern
bleibt um den 2-Minuten-Bereich konstant.
Aber es gibt auch noch andere Sportarten und sicherlich ehrt es mich sehr, gefragt zu werden, ob ich noch in Wettkämpfe einsteigen
möchte, wozu ich auch große Lust habe - aber will ich das Alter mit Arthritis verbringen?
08.03.2007, Maren Rehder (- ergänzt am 22.04.2010 -)
Verblüfft stelle ich fest, dass - sofern ich angetreten wäre - z. Z. bundesweit in meiner Altersgruppe (AK 40-44) über
1500 m auf Platz 2 käme, da ich diese Distanz unter 33 bzw. 34 Minuten schwimme, aber nicht unter 30 Minuten!
Die beste gemeldete Schwimmerin des DSV bewältigt diese in phänomenalen 19:37,35 Min. (Elke Hagedorn, Jg. 65),
die z. Z. zweitbeste in 33:46,02 Min. (Ilga Stolte, Jg. 67) auf einer 50-m-Bahn. Da ich selbst die 1000 m am vergangenen
Sonntag in 20:50 Minuten hinter mich brachte und vor einigen Monaten bei ca. 31 Minuten und etlichen Sekunden die 1500 m
schwamm, wäre ich wohl sicherlich sogar noch vor der Zweitplazierten herausgekommen. Dieses mag aber auch mit daran
liegen, dass nicht alle sehr guten Schwimmerinnen gemeldet sind. So minimiert sich die Konkurrenz und selbst
Seiteneinsteigerinnen wie ich hätten eine Chance. Ein Nachlassen des Trainings rächt sich sofort in schlechteren
Schwimmzeiten - im Sommer ist das Trainieren leichter aufgrund angenehmerer Temperaturen.
Außerdem ist es für die Zeitnahme relevant, ob auf 25- oder 50-m-Bahnen geschwommen wird.
24.05.2007, Maren Rehder
"Ich nehme dich auf meinen Rücken, vermähle dich dem Ozean."
Johann Wolfgang von Goethe
Lesetipp: John von Düffel (Hg.), Charles Sprawson. Schwimmen - eine Kulturgeschichte, Hamburg 2002.
SchwimmerInnen galten bis ins 18. / 19. Jh. hinein in Europa als gesellschaftliche Außenseiter.
Das Körperbewusstsein der SchwimmerInnen widersprach gesellschaftlichen Konventionen.
Johnny Weissmüller bevorzugte Wettkämpfe, deren Ergebnisse nicht von den Launen der Kampfrichter abhingen (S.273).
Nicht wenige bezahlten diese sportliche Begeisterung mit ihrem Leben. Alick Wickham z. B. war gegen die Gage von 100 Pfund
aus 60 Metern Höhe von einer Plattform in den Yarra River bei Melbourne (Australien) gesprungen, nachdem er von den
Veranstaltenden hereingelegt worden war. Diese hatten ihm verschwiegen, dass der verabredete Schwalbensprung von einer Plattform
aus 30 m Höhe eigentlich aus über 60 m ausgeführt werden musste, da die Plattform ihrerseits auf einer über
30 m hohen Klippe stand. Wickham überlebte und lag nach dem Sprung eine Woche im Koma. Die Wucht des Aufpralls hatte ihm
die drei Badeanzüge, die er sicherheitshalber angelegt hatte, vom Leib gerissen (S. 274).
BITTE NICHT NACHMACHEN!
Ein Nachsatz zur Meditation aus einer Yoga-Stunde: "Das Meer bietet unermessliche Schätze. Sicherheit findet sich am
Strand."
Maren Rehder, 13.01.2008
John von Düffel, der selbst Schwimmer ist und sich nach eigenen Angaben als Dramaturg und Schriftsteller in der
Spannung von Kultur und Natur bewegt, schreibt trefflich im Vorwort des genannten Buches über das Motiv des Schreibens
über das Schwimmen, dass dieses nicht aus dem aktuellen Zustand des Einsseins mit dem Wasser entspringt, sondern ein Produkt
der Sehnsucht, des Durstes nach dem Schwimmen darstellt. Das Schreiben über das Schwimmen findet nach dem eigentlichen
Schwimmvorgang statt, den von Düffel als eine Art Trance oder Traum empfindet und welches symbolisch den Wunsch in sich trägt,
möglichst bald wieder in diesen Traum eintauchen zu können.
Maren Rehder, 22.08.2010
Über 1500 m Kraul konnte ich meine Schwimmzeit im Vergleich zum Vorjahr mit 32/33 Minuten in etwa halten bei analoger
Zeitmessung auf einer 50-m-Bahn. Trainiert hatte ich auch für meine Verhältnisse nur mäßig - von daher bin ich
summa summarum ganz zufrieden.
Maren Rehder, 30.05.2008
Zum Glück gelang es mir noch, die 25 m Strecke ein paar Mal zu tauchen. JETZT KANN DER SOMMER KOMMEN!
Maren Rehder, 01.06.2008
Da mein Wohnort am Wasser bzw. Meer ist, finde ich es wichtig, sich mit Rettungsaktionen im und am Wasser vertraut gemacht zu
haben. Man kann nie wissen und ist nicht hilflos, sollte einem die Situation begegnen, dass jemand im Wasser in Not geraten
ist. Die Prüfung zum Rettungsschwimmer beinhaltet profunde Kenntnisse und geübte Anwendungen in Fragen der Wasserrettung.
Ich bin froh, dass ich die Anforderungen in diesem Sommer noch einmal bewältigte.
Maren Rehder, 13.08.2008
Oh, ich könnte Pfähle umarmen - meine derzeitige Rettungsschwimmprüfung stand auf tönernen Füßen!
Ich hatte zu Beginn der Prüfung PANIK vom 3er zu springen - und das mir!
Mehrfach war ich vom 3er wieder herabgestiegen, weil mich "da oben" einfach das "P" ergriff! Mein Vertrauen in die
Elemente - dass sie mich tragen - war einfach fort!
Ich glaubte, ich würde es NIE mehr können, Sich-Fallenlassen mit der Gewissheit, unten unversehrt anzukommen!
Einige Male betrat ich 3-m-Türme und verließ sie wieder - unverrichteter Dinge!
Auch dachte ich an den Lebenskünstler Stefan Raab, der sich immer wieder Herausforderungen stellt - aber auch das
half nur wenig. Dann traf ich eine andere Rettungsschwimmerin, die mir dazu riet, sie einmal im Freibad Katzheide zu besuchen,
nachdem ich ihr gesagt hatte, dass ich glaube, dass ich in Katzheide springen könnte.
Den Sprungturm in Katzheide finde ich irgendwie sympathisch - er ist für alle da, also auch für mich.
Hinzu kam, dass ich eben eine Rettungsschwimmerin kenne, die dort arbeitet und mich gleich an ihren sehr einfühlsamen,
aber bestimmt auftretenden Chef verwies, der mir in der Höhe von 3 m gut zusprach und am Turm stehen blieb, als noch ein kleiner Junge,
der vom 5er sprang und ich unsere Angst besiegen wollten. Auch noch eine andere freundliche Aufsicht, die derweil auf dem 5er stand,
ermutigte den Jungen und auch mich. Mit zusammengekniffenen Augen sprang ich nach noch nicht einmal einer Minute in die Tiefe!
Was war geschehen?
Mein erster Versuch im Rahmen der Prüfung, an dem ich scheiterte, hatte möglicherweise eine Ursache darin, dass ich vor
Kälte zitternd auch noch damit konfrontiert war, dass noch zwei Personen vor mir standen und davor noch ein
ca. 1 m "großer" Junge von dem Brett springen sollte, dessen Angst umgekehrt proportional zu seiner Körpergröße
zu sein schien. Auch wirkte das Brett enorm mächtig im Vergleich zur Physis des Kleinen. Bestimmt dauerte es 10 Minuten,
während andere auf ihn einsprachen, bis er letztlich seine Angst bändigte und sprang. Mit Herzrasen verließ
ich den Turm - ohne das erforderliche Prüfungsergebnis. NEIN! NIE UND NIMMERMEHR!
Ich sagte wörtlich zu dem Prüfer, während meine Augen das Brett fokussierten, dass ich dort NIE mehr
herunterspringen werde! Ich müsste in meinem Alter nicht mehr alles können! Das ist jetzt rd. 6 Wochen her.
Allenfalls wollte ich noch "Bronze" erwerben. Der Prüfer meinte selbstbewusst, er hätte da bisher noch jeden
"herunterbekommen". Ich zweifelte an dessen Optimismus in meinem Fall, denn ein anderer möglicher Grund war, dass ich nicht
springen wollte, weil ich in den letzten Jahren einige Unfälle erlitt, die mich verunsicherten. So war ich im Jahr 2009 mit
dem Fahrstuhl stecken geblieben und mich befiel tatsächlich die Phantasie, ich würde nicht unten ankommen, sondern nach
dem Springen in der Luft auf seltsame Weise stehen bleiben (siehe z. B. auch Mr. Bean goes to the swimming pool).
Nachdem ich in Katzheide begleitet von positivem Zuspruch dann relativ zügig gesprungen war und mir dieses
sicherheitshalber dokumentieren ließ, versuchte ich mein Glück auch noch in einem anderen Freibad, wo ich schon
als Kind gesprungen war. Das klappte quasi problemlos, sogar ohne "Betreuung" - auch hier ließ ich mir den Sprung zur
Sicherheit schriftlich bescheinigen (Dass ich mit 44 Jahren durch norddeutsche Städte mit so einem Schrieb in der
Tasche fahre, hätte ich mir auch nie träumen lassen:-).).
Mein Paradesprung fand dann aber heute abend statt: In der Prüfungshalle meldete ich bei passender Gelegenheit an, nun vom
3-m-Brett springen zu wollen. Zügig betrat ich den Turm und sprang und vertraute den Elementen wieder mehr - unter Beifall
(In der Gruppe herrscht ein guter Teamgeist - ... selten so etwas erlebt!) tauchte ich aus dem Wasser auf. Das habe ich mir
wirklich erarbeitet - ich danke dem Sport und einigen guten Umständen, dass ich mich da herantasten konnte und es
schließlich noch einmal schaffte, eine Grenze zu bearbeiten.
Am Sport finde ich faszinierend, dass auf relativ friedliche Weise mit Herausforderungen umgegangen werden kann (Inzwischen
- heute ist der 20.08.2010 - bin ich 14 x aus 3 m Höhe gesprungen.).
Sportliche Betätigung ist viel MEHR als das Abspulen physischer Bewegungen nach bestimmten Schemata - diese Komponente
wird im Schulunterricht häufig außer Acht gelassen oder kann aus organisatorischen Gründen - wie in anderen
Fächern auch - nicht vermittelt werden. Leider gehen den Fächern somit Wesenszüge verloren, ihr qualitativer
Gehalt kann dadurch beizeiten nicht erfahren werden, da für ganzheitliche Ansätze offenbar kein Raum ist.
Obwohl dieses Fach wichtige Kompetenzen trainiert, bleibt es vielfach unterbewertet mit seiner Stellung innerhalb des Schulkanons.
Weil Schleswig-Holstein zwischen zwei Meeren liegt (Die Ostsee ist aufgrund eines niedrigeren Salzgehalts als Brackwasser
zu bezeichnen und von daher nur ein "Scheinmeer".), möchte ich dazu ermuntern, einmal die vielseitigen und umfassenden Prüfungs-
programme von DLRG und Wasserwacht mitzumachen und sich dem Thema "Wasserrettung" anzunähern. Zudem handelt es sich dabei um
eine sinnvolle Abend- und Freizeitbeschäftigung, die in einer ernsten Situation sogar von unschätzbarem Wert sein kann.
Maren Rehder, 21.06.2010 (- ergänzt am 20.08.2010 -)
Tja, im Grunde bin ich immer noch sprachlos bzw. fasziniert von den vielen verschiedenen Eindrücken und Sinneserfahrungen,
die mich bis in den Spätsommer und Herbst hinein tragen und hoffentlich noch lange begleiten werden.
Aus unserem ursprünglich für eine Woche eher spontan angesetzten Schwimm-Kurs im Freibad Katzheide entwickelte sich wegen
der hohen Nachfrage ein vierwöchiges (kostenloses) Schwimm-Camp. Beinahe an jedem Tag trafen wieder andere Kinder an unserem
Stand ein und wollten endlich das "Seepferdchen" erwerben oder sogar für das "DJSA Gold" schwimmen oder anderes. Insgesamt hatten drei
Rettungsschwimmer/innen bzw. Ausbildende mit 70 teilnehmenden Kindern vorwiegend aus dem Primarbereich zu tun und mit ebenso
vielen individuellen Schwimmstilen. 56 Schwimmprüfungen verschiedener Güteklasse wurden mit Eifer, Training und durch
Weiterentwicklung abgelegt. Auch bei schlechtem Wetter und kälteren Temperaturen war der Wissens- und Bewegungsdrang
der Kinder nicht zu bremsen. Viele von ihnen gehen hoffentlich gestärkt und positiv motiviert sowie mit neuen Selbsterfahrungen
in das beginnende Schuljahr und hatten ein schönes und sinnvolles Ferienerlebnis!
Mir kam es bisweilen so vor, als wäre Katzheide ein ferner Ort, z. B. in Südeuropa, und ich wäre mindestens für
4 Wochen "weg" gewesen. Danke!
Maren Rehder, 23.08.2010
TOTAL IMMERSION: "Schwimmen nach Art der Fische" möchten uns Terry Laughlin und John Delves in ihrem Buch näher bringen.
Ein Fehler der Menschen sei es gewesen, jahrelang Schwimmen nach Menschenart zu lehren. Laughlin und Delves versuchen auch unter
Berücksichtigen intuitiver und ganzheitlicher Aspekte einen Zugang zum nassen Element zu eröffnen.
Anhand der Konzentration auf die Kraul-Technik wird auf insgesamt 336 Seiten sowohl detailliert als auch vielfältig unter
Einbinden interessanter Trainingsreihen geschildert.
Mir gefällt das Buch nicht zuletzt wegen seines Erzählstils und aufgrund des Versuchs, die emotionale Seite - das empathische
Sichhineinversetzen in die Bewegungen des Schwimmens - nicht auszublenden und gelingendes Schwimmen eher als Kunstform darzustellen.
Stumpfes Technikabspulen und "hirnlose" Kraftübungen machen einen guten Schwimmer, eine gute Schwimmerin nicht aus.
Es geht beim Erlernen und Verbessern des Kraulens immer auch darum, das Wasser zu spüren und es als Partner zu betrachten.
Die Technik sollte sich dabei dem Element "nach Art der Fische" anpassen, den Körper z. B. widerstandsärmer in Gleitphasen
ausrichten etc.
Des Weiteren werden interessante Vergleiche zum Yoga, Tai Chi und Kampfsport gezogen, welche sich z. B. beim Schwimmen auf das Verhältnis
von entspannenden und anspannenden Bewegungen beziehen. Im Grunde kann TOTAL IMMERSION als grundlegende Philosophie für sämtliche
Sportarten gelten.
Maren Rehder, 08.09.2010
Die 20er Marke wollte ich zum Ende des Sommers noch knacken - schade, dass die Freibad-Saison endet - am Abend des 10.09.2010 sprang ich
in diesem witterungsmäßig eher durchwachsenen Sommer zum 20. Mal aus 3 m Höhe.
So oft bin ich in Kindertagen nicht einmal gesprungen. Die noch fehlenden 4 Sprünge bis zum 20. Mal sprang ich an diesem einen
Abend (Die Sprünge 15 und 16 waren an zwei vorherigen Abenden erfolgt.).
Nach meinen ersten Schwimmversuchen "nach Art der Fische" (s. o.) stellte ich fest, dass ich zwar nicht wesentlich schneller wurde, jedoch
viel erholter und entspannter schwamm. Offenbar bin ich nicht die einzige, die von dieser grundlegend neuen Schwimmart erst ca. 15 Jahre
nach Entstehen des Buches von Laughlin und Delves erfuhr. Wieso in den meisten gut bebilderten Schwimmbüchern darauf keine Zeile
"verschwendet" wird, bleibt nicht nur mir ein Rätsel. Vielleicht habe ich einen Haken an der Sache übersehen, oder liegt das
wenig verbreitete Wissen darüber an dem eher ineffizienten Schreibstil der Autoren, dem wenigen Bildmaterial und an konventionellen
Denkmustern?
Maren Rehder, 14.09.2010
Meine ersten Kontakte mit freierem Wasser fanden vermutlich in der Elbe statt, als ich ca. 2 Jahre alt war.
Schwimmen lernte ich sodann noch vor dem Schulbeginn von meinem Vater, der sich ca. 2-mal intensiv - trotz seiner Vollzeitbe-
schäftigung - dazu die Zeit nahm und mir im Nichtschwimmerbecken z. B. seinen Arm unter den Bauch hielt, bis ich alleine losschwamm.
Mit den wenigen Metern, die ich plötzlich "schwebend" hinter mich brachte, war ich zunächst nicht recht zufrieden, aber mein Vater
meinte, dass ich von nun an auch ohne seine Hilfe weiterschwimmen und immer wieder probieren sollte, was ich im ersten Moment ungläubig
für unmöglich hielt.
Etwas später erfolgte noch eine offizielle Prüfung, zu der ich eigentlich keine Lust hatte, unter Aufsicht des Bademeisters, der mich
so lange einfach schwimmen ließ, bis ich das sogenannte Fahrtenschwimmer-Abzeichen bestanden hatte, was mich ebenso überraschte wie erfreute.
Danach legte ich allerdings lange Zeit keine einzige Schwimmprüfung mehr ab und trainierte das Schwimmen auch nicht in besonderer Weise.
Das Schulschwimmen habe ich als sehr kurz und hektisch in Erinnerung - ich hatte nicht den Eindruck, dass es in besonderer Weise geübt o. a.
wurde. Es stand wohl auf dem Lehrplan und musste als Teil des Unterrichts praktiziert werden, was auch nur selten der Fall war.
Letztendlich kam es mir so vor, dass Schwimmen in der Schule nicht gerade motivierend, sondern eher unpassend wirkte, weil es mit sehr
viel Aufwand verbunden war. Der Stundentakt kollidierte mit der offenen und fließenden Schwimmerfahrung im Wasser.
Freude bereiteten mir eher meine eigenen Aktivitäten wie vom 5er springen, Saltos schlagen oder sich Spiele im Wasser ausdenken.
Über dieses eigene Engagement von mir war ich immer ganz froh, da es vielleicht mehr zur Sache beitrug, als ein sehr fremdbestimmtes
und wenig passendes "Didaktisieren". Menschen sind eben verschieden - was bei den einen zum Ziel führt, ist bei anderen nicht
ebenso von Erfolg gekrönt. Auch ist die Methode des Segmentierens von komplexen Bewegungsabläufen und das nachträglich
erfolgende logische Zusammensetzen dieser Einzelteile zu einer Gesamtbewegung nicht immer sinnvoll, da es Menschen gibt,
die eher sprunghaft lernen, bei denen plötzlich ein "Aha-Effekt" eintritt, der bei einem Beharren auf logischen
Trainingsabfolgen eher blockiert würde. Von daher sehe ich es gerade als besonders schwierig an, die richtige Didaktik zu finden.
Für wen ist diese richtig? Sie kann vielleicht allenfalls als ein Beispiel dienen.
Maren Rehder, 26.09.2010
Schön ist, wenn sich Menschen aus Lust und Interesse zu freien oder - wie Terry Laughlin (s. o.) schreibt - zu "informellen" Schwimm-
gruppen zusammenfinden. Ein reger Informationsaustausch und gegenseitige Korrekturen wirken wie eine "lebendige Schwimmschule", die auch
den "inneren Schweinehund" überwinden hilft, wenn es um das Wahrnehmen von ungewohnten Trainingszeiten geht. Die Mitschwimmenden
coachen sich untereinander und gegenseitig. Interessant sind die jeweils unterschiedlichen Probleme oder Themen, mit denen sich jedes
"Mitglied" gerade beschäftigt. Bei dem einen ist es der Armzug der Rückenkraulbewegung - bei dem anderen die Gleitphase beim
Vorwärtskraulen. Laughlin rät jedem und jeder Übenden dazu, jedoch jeweils nur ein Problem zur Zeit zu behandeln.
Maren Rehder, 27.10.2010
So bin ich dankbar für "meine" informelle Schwimmgruppe, in der sich z. B. Menschen zusammenfinden, die sowohl schlaue Bücher
lesen und verstehen als auch schwimmen und z. B. Muesli-Brötchen backen können. Tja, bei "uns" schenkt man sich - selbstver-
ständlich erst nach dem Schwimmen - auch schon mal Selbstgebackenes - eine von mir fabrizierte Apfel-Tarte wechselte schon
mal den Spind u. a. Ich würde von Ansätzen zu einem ganzheitlichen Coaching sprechen, das über das reine Schwimmen
an sich (frei nach Kant) hinausgeht.
Übrigens stehe ich prinzipiell und ehrenamtlich (Gegen einen kleinen Obolus hätte ich je nach Art und Umfang der Tätigkeit
jedoch auch nichts einzuwenden.)zur Unterstützung von Schwimmprojekten als Rettungsschwimmerin und für Unterricht bzw. zur
Vermittlung von Schwimmtechniken zur Verfügung (nach Anfrage per E-Mail). Z. Z. habe ich das Glück, mit einer Gruppe von
7- bis 10-Jährigen zu arbeiten. Auch mit erwachsenen Schwimmenkönnenden bzw. Nichtschwimmenkönnenden hatte ich bereits zu tun.
Wichtig ist mir, dass das Wasser als Partner behandelt wird und sich der menschliche Körper nicht gegen diesen und nicht gegen sich
selbst bewegt. Das Üben von vielfältigen Bewegungsformen (z. B. sensorische Erfahrungsübungen; Brust-, Kraul-, Delphintechnik)
unter Einbeziehen rettungsschwimmerischer Aspekte und auf der Basis einer exakten Technik bilden für mich Schwerpunkte.
Die "Abzeichenjagd" spielt aus meiner Sicht nur eine Nebenrolle und ergibt sich eher zwangsläufig als Folge aus dem schwimmerischen
Vermögen. Dass nicht alle in einer Disziplin gleich abschneiden, sollte im Vergleich mit anderen transparent werden können und
auf Akzeptanz stoßen - denn m. E. n. steht die Sache im Vordergrund - dann erst kommen mögliche Abzeichen in Betracht.
Schwimmhilfen wie Schwimmbrett oder Pull-Buoy u. a. versuche ich mittlerweile wegzulassen, da es um das Erlernen eines ganzheitlichen
Bewegungsablaufs geht, bei dem nicht Kraft, sondern Technikpräzision im Zentrum steht. Unterstützend für den Aufbau der
Armmuskulatur beim Kraulschwimmen wirken z. B. Trockenübungen mit dem Thera-Band oder das Schwimmen mit flexiblen Schwimmhandschuhen.
Der Bewegungszyklus beim Kraulschwimmen wird aus der Körperbalance und dem Hüftschwung heraus entwickelt.
Ein gutes Training berücksichtigt zudem das Verhältnis von aeroben und anaeroben Phasen in jeweiliger Abstimmung auf das zu
erreichende Ziel, z. B. Kurz- oder Langstrecke. Das Verbessern der Ausdauer mit aerober Akzentuierung ist aber in jedem Fall eine
solide Voraussetzung zur Tempussteigerung sowohl auf kurzen als auch auf langen Strecken.
PS: Bei Kindern erfreuten sich meine Aufnahmen mit der Unterwasserkamera besonderer Beliebtheit. Was für Kinder gut ist, kann auch
bei sogenannten Erwachsenen nicht ganz verkehrt sein! Auch helfen Unterwasseraufnahmen die Scheu vor dem Tauchen abzulegen.
Maren Rehder, 02.12.2010
"Wer krault, bewegt sich in einer anderen Welt, er liefert sich dem Wasser auf Gnade oder Ungnade aus. ...
Brustschwimmen ist im allgemeinen die erste Schwimmdisziplin, ..., die erste der Menschheit. Mit der Festlegung
dieses Bewegungsmusters hat man schon früh versucht, systematisch dem Ertrinken zu entgehen - ... Und diese
uralte Angst vor dem Ertrinken merkt man dem Brustschwimmen immer noch an. Aus dieser Angst heraus strebt der Körper
mit jedem Zug der Vertikalen zu. ...
Brustschwimmen war für mich immer ein halbherziger Abschied vom Land, ein ängstliches Festhalten an dem
Prinzip der vertikalen Gangart und der optischen Orientierung des Vorausschauens. Wir verzichten beim Brustschwimmen
nicht auf unser gewohntes Gesichtsfeld und genausowenig auf unseren zweiten Fernsinn, das Hören, sondern behalten
im Wasser unverändert die Wahrnehmung bei, die auch unser Leben an Land bestimmt. Gerade deshalb ist dieser Schwimm-
stil zur vorsichtigen Annäherung an das andere Element so geeignet, und gerade deshalb ist es so schwer, beim Brust-
schwimmen ganz im Wasser aufzugehen.
Um kraulen zu können, muß man seine Wahrnehmungsgewohnheiten überwinden. Es erfordert Mut, alle Sinne auf
das Wasser einzustellen. Es braucht ein großes Maß an Umgewöhnung und Vertrautheit mit dem Wasser, damit
es nicht gleichzeitig in Mund und Nase einströmt. Das seitliche Einatmen knapp über der Wasseroberfläche und
das Ausatmen unter Wasser müssen sich ruhig und gleichmäßig abwechseln, während man die Arme weit
nach vorne bringt, durchzieht und wieder aufs neue ausholt. Und obwohl beim Kraulen der Armzug fast ausschließlich
für den Antrieb sorgt, schlagen die Beine mit nach innen gerichteten Fußspitzen ihren wechselnden Takt, damit
der Körper nicht weiter als zehn, fünfzehn Zentimeter unter die Oberfläche absinkt und sich in seiner Um-
hüllung aus Wasser geradlinig vorwärts bewegt. ...
Ich halte die Horizontale, mein Gesicht antwortet der Tiefe des Wassers bis auf den Grund. Und mir wird klar, dass ich
die Koordinaten meiner Landexistenz hinter mir gelassen habe. ... Das Wort `Horizont` ist sinnlos geworden, solange es
die Schnittlinie von Luft und Wasser meint, die man beim Brustschwimmen stets im Auge behält. Mein Horizont ist das
Wasser selbst, seine Tiefe und die Traumlandschaft des Grundes. Ich trenne Luft und Wasser nicht mehr, ich bin ein Teil
dieser Wasserwelt geworden. Und ich versuche, die offene Seite beim Luftholen so weit wie möglich zu schließen,
ich atme nur noch durch einen verschwindend dünnen Spalt, durch die Ritze einer Tür, die ich hinter mir zuge-
schlagen habe, und ich genieße das Umschlossensein vom Wasser, denn das ist das Ziel meiner Strecke: nicht der An-
schlag am Beckenrand, das Erreichen des Ufers oder irgendein Ende an Land, sondern die Einheit von Wasser und Bewegung,
die Zugehörigkeit zu diesem Element. Ich strebe Wassergleichheit an."
(Aus: John von Düffel, Schwimmen, 4. Aufl., München 2007, S. 51 ff.)
Von Düffel hat das Glück, positive Erfahrungen mit dem nassen Element gemacht zu haben - selbstverständlich
scheint der Autor als Teilnehmer einer Wettkampfmannschaft jedoch auch Kampfgeist gegen negative Erfahrungen zu besitzen.
Dennoch fällt es einigen Menschen schwer, ihre negativen Erfahrungen mit Wasser, die z. B. aus ihrer Kindheit unter
Kriegsbedingungen stammten, gegen positive Erlebnisse auszutauschen. Obwohl der Wille zum Schwimmenlernen vorhanden ist,
siegt ihre Angst aufgrund des Geschehenen.
Auch Erwachsene, die in dem Sinne nicht auf Negativerlebnisse zurückblicken, können oftmals nicht schwimmen.
Entweder erhielten sie nie einen Bezug zur Bewegung im Wasser durch z. B. ihre Familie, oder die Vorstellung des Ertrinkens
in tiefem Wasser fürchtet sie so, dass sie sich dem Element nicht anvertrauen möchten. Manchmal hängt das Meiden
des Wassers aber auch mit einem schlechten Selbstbild zusammen - es wird sich nicht zugetraut, das Schwimmen erlernen zu
können.
In krassem Gegensatz dazu verhalten sich die Erfahrungsberichte von "Hydrophilen". Vielleicht ist jenen die Gefahr des Was-
sers auch bewusst - diese reizt sie anscheinend.
Rüdiger Nehberg soll seine Wasserscheu durch ein konfrontatives Training mit Kampfschwimmern überwunden haben.
Das Unbehagen, sich im Wasser zu bewegen, ist also weit verbreitet.
Wie Gehen, Laufen und überhaupt sich Fortbewegen an Land Selbstverständlichkeiten sind, so stellt m. E. n. auch das
Schwimmen eine solche Grunddisziplin dar, welche zu den existenziellen Grundfertigkeiten des Menschen zählt und mög-
lichst viele Menschen beherrschen müssten.
Insbesondere in einer Stadt am Meer oder an einem Fluss sollte das AnfängerInnenschwimmen kostenlos oder gegen einen
symbolischen Beitrag unterrichtet werden.
Von Düffels Bewertung der Schwimmarten kann ich zwar nachvollziehen, aber ich denke, dass es auch eine Frage des Typs
sowie der körperlichen Voraussetzungen ist, für welche Schwimmart letztlich die Entscheidung ausfällt. Die
Wahl des Schwimmstils bildet nicht automatisch das Verhältnis der Schwimmenden zum Wasser ab - je nach Preferenz kann
sich diese Wahl auch aus dem schnellsten Schwimmtempo in Relation zu Körperbau und Technik ergeben.
Bei der Technik des Kraulens möchte ich anmerken, dass nicht die Arme allein den Vorschub bewerkstelligen, vielmehr er-
folgt bei einem ganzheitlichen Bewegungsablauf, der Antrieb aus der Körper- und Hüftrotation heraus - bzw. aus der
Körpermitte - wie bei einer Feder, die sich aufzieht und entspannt, dieses wiederholt und sich somit vorwärts "schraubt".
Maren Rehder, 07.02.2011
Beim Schwimmen lassen sich irrwitzige Dinge erleben. So bin ich neulich eher "zufällig" in ein Gespräch unter
Männern geraten und sollte auch noch als Demonstrationsobjekt herhalten. Die haben Probleme - oh, "mann"!
Die Halle war mal wieder voll wie bei der Schnäppchenjagd, die Sprunganlage war geöffnet, und es waren viele "Sonntags-
schwimmende" unterwegs. Nur an einem Rand tummelte sich ein versprengtes Grüppchen von Herren, die mühsam ihre Bahnen
zogen und denen es offenbar bisher nicht gelungen war, ein System zu bilden. Es handelte sich insgesamt um drei Herren, die
alle ein ähnliches Tempo schwammen. Auch ich wollte mich dazu gesellen, nachdem ich etliche Versuche, eine Bahn durchzu-
schwimmen, abbrechen musste.
Allerdings schwammen die Herren eher nebeneinander als in harmonischer Eintracht. So stellte ich fest, dass zwei Herren para-
llele Bahnen benutzten, aber immer auf einer Bahn hin- und zurückschwammen, so dass ich mich schon dicht an die Fersen
des einen oder anderen heften musste, um nach der Wende der Herren nicht mit anstrengendem Gegenverkehr rechnen zu müssen.
Na ja, mal gelang es mir, dann wechselte ich den Herrn und auch die Bahn, dann schwamm wieder irgendein gerade gesprungenes
Kind dazwischen, und dann hatte ich wieder mit Gegenverkehr zu tun, weil auch noch ein dritter Herr ähnlich wie ich das "Bahnen-
Hopping" praktizierte. Am Beckenrand gestand mir dann dieser eine Herr, der offenbar in dem Moment meine Gedanken erraten
konnte, dass er gerne im Kreis mit den anderen schwimmen würde, was ich sehr begrüßte. Dazu sprach er den
einen anschwimmenden Herrn selbstbewusst an. Dieser erwiderte während der Wende nur, dass er das nicht mitmachen würde.
Dann schaute ich den Herrn, der die Initiative ergriffen hatte, etwas ratlos an und mutmaßte, dass der andere Herr, der
ebenfalls auf immer derselben Bahn hin- und zurückschwamm, vielleicht dazu bereit wäre.
Der Herr, der die Initiative ergriffen hatte, brach seine Versuche jedoch ab und fragte diesen noch verbleibenden Herrn nicht.
Ich dachte mir dann nur, dass ich eben genauso "unsozial" wie die beiden besagten Herren schwimmen werde in der Hoffnung,
diese würden dann von sich aus die Vorteile des Kreisverkehrs - eine Bahn wird zum Hinschwimmen benutzt, eine andere
für den Rückweg - erkennen und ihre Schwimmweise in sozialere Bahnen lenken.
Am anderen Ende der Bahn fasste ich aber den Entschluss, den Herrn, der seine Unterstützung versagt hatte, nochmal zu
fragen, was ich dem Herrn, der die erste Initiative dazu ergriffen hatte, ein wenig nach Motivation suchend mitteilte.
Als ich beim Wendevorgang das Ohr des "Verweigerers" an der Wasseroberfläche entdeckte, rief ich sodann dort hinein, ob
wir vielleicht im Kreis schwimmen könnten. Ich wartete gespannt auf seine Reaktion und war etwas überrascht, als
dieser Herr entgegen meiner Erwartung nicht stur weiterschwamm, sondern plötzlich umdrehte, sich langsam aufrichtete,
was seine Körperlänge mit imposanten, geschätzten 1,90 m ++ zum Erscheinen brachte, seine Schwimmbrille abstrich
und erst einmal für einen Moment schwieg. In diesem Moment arbeiteten in meinem Gehirn blitzschnell einige Gedanken, die
mehr von Flucht als von Zuversicht handelten. Auch glaubte ich, jeden Moment mit einer Verbal-Ohrfeige gestraft zu werden.
Seine dunklen Augen durchdrangen mich, wie wenn ich ihm gerade das Portemonnaie gestohlen hätte o. ä.
Ich glaubte kaum, was ich dann hörte. Er wäre prinzipiell für Kreisverkehr offen, aber der Herr, der ihn ange-
sprochen hätte, hätte ihn so unsanft am Finger berührt, dass dieser nun vermutlich gestaucht wäre und so
hätte er dessen Anfrage kategorisch abgelehnt.
Ich atmete tief durch. Da tauchte auch schon der Herr auf der anderen Seite des Körpers dieses "Herrn mit dem verstauchten
Finger" auf, der wesentlich weicher und schmächtiger als der lädierte Herr wirkte, aber bestimmt dennoch ca. 1,80 m
maß. Dieser bekam nun detailliert geschildert, dass durch sein unsanftes Anhalten des Schwimmens der Mittelfinger
gestaucht worden wäre, und er auf diese Weise keinem Kreisverkehr zustimmen würde.
Sodann tippte mir der Herr mit der gesunden Hand wiederholt kräftig auf die Schulter, um zu demonstrieren, wie korrektes
Anhalten eines oder einer Schwimmenden vonstatten gehe. Der 1,80er hätte zwecks des Stoppens einer schwimmenden Person, dieser
sanft an die Schulter zu tippen. Schon wieder klopften seine Finger auf meine Schulter, und ich fand, dass das gar nicht mal
so sensibel erfolgte. Ich diente als pädagogisches Vorzeigeobjekt.
Während sich die beiden noch über die richtige Art des Stoppens eines oder einer Schwimmenden unterhielten, sprach ich
den noch verbleibenden Herrn an, ob er sich entscheiden könnte, im Kreisverkehr zu schwimmen. Auch dieser willigte freund-
lich ein.
Der 1,90 m-Mann sagte zuletzt, dass er bereits seit 40 Minuten im Wasser wäre und das Schwimmbad sowieso nun verließe.
Der 1,80 m-Mann hatte sich inzwischen unzählige Male und demütig bei dem 1,90er wegen der Verursachung des Fingerstauchens
entschuldigt. Obwohl ich etwas anderes dachte, sagte ich, dass wir uns dann freuen würden, wenn wir den "geschädigten
Herrn" beim nächsten Mal in "unserem" Schwimmkreis begrüßen könnten. Eine Weile saß er dann noch auf
dem Beckenrand, bis er hinter irgendwelchen Türen verschwand.
Ich weiß nicht genau, wieviele Male mir auf die Schulter getippt worden war, um zu demonstrieren, wie ein korrektes An-
halten von Schwimmenden funktioniert. Jedenfalls war das Schwimmbad so voll, dass ich auch noch einen intensiven Schluck des
Chlorwassers mit nach Hause nahm, als mir die Welle eines Springers ins Gesicht schwappte.
Zu guter Letzt freute sich der etwas kleinere Herr, dass der Kreisverkehr relativ reibungslos bis zum Ende der Badezeit herge-
stellt werden konnte und sich noch andere Personen diesem anschlossen.
PS: Ein anderes Mal werde ich VIELLEICHT noch die Geschichte erzählen, wie es dazu kam, dass ich am Tag nach dem Schwimmen
mit rot unterlaufenen Augen aufwachte und wieso es eine Lüge ist, dass AsthmatikerInnen vom Chlor krank geworden sind,
weil sie sich vor dem Schwimmen nicht richtig gewaschen haben.
Maren Rehder, 07.02.2011
Also, mit den "roten Augen" ist es so - einfach erklärt: Wenn z. B. zuviel "Pipi" und zuwenig Chlor im Wasser sind, entstehen bei
manchen Leuten "rote Augen". Meistens stammt das "Pipi" nicht von der Person, die davon "rote Augen" kriegt, sondern von anderen.
Das ist besonders tragisch, wenn eine relativ wichtige Erledigung ansteht, wie ich sie mit so angelaufenen Augen vorhatte.
Allerdings kann dieses auch beim Gegenüber mitleidsbedingte, ansonsten unerwartete Hilfsbereitschaft auslösen - also,
"rote Augen" müssen nicht unbedingt gleich schlimm sein, sie sehen nur komisch aus!
Die Sache mit dem Asthma ist hingegen etwas komplizierter. Falsch ist nur die Behauptung, dass Menschen, die allergisch oder asth-
matisch auf Chlor reagieren, dieses deshalb tun, weil sie sich nicht richtig gereinigt haben, worauf in besonderem Ausmaß
eine Chlorreaktion auf ihrer Haut zu diesen Dispositionen führte. So entstehen Vorurteile, und es heißt schnell, "die
oder der wäscht sich nicht richtig und hat deshalb Asthma", was völliger Unfug ist, da es offenbar mit einer Art Neigung
oder Veranlagung zusammenhängt, ob eine allergische oder asthmatische Reaktion eintritt oder eben nicht. Wenn dann noch an-
dere Außenseiterkriterien mit diesem Menschen verbunden werden, ist das Bild einer "persona non grata" perfekt - eine Ab-
wärtsspirale entsteht durch Andichtung: "Die oder der ist nicht nur schlecht in der Schule, sondern stinkt auch und hat
deswegen Asthma und davon kommt, dass diese Person nicht pünktlich und somit nicht zuverlässig ist, darüber hinaus
bestimmt die verschwundene Geldbörse klaute, denn sonst hätte die oder der ja keine schlechten Noten!"
Eine mit Logik verbundene Tatsachenorientierung lässt in solchen Denkschemata häufig zu wünschen übrig.
Außerdem müsste dann ja allen AsthmatikerInnen prinzipielle Unreinheit unterstellt werden, was totaler Quatsch ist!
Allgemeine Reinlichkeitshinweise vermittelt z. B. sehr anschaulich folgendes Video: http://www.youtube.com/watch?v=i_N_T_CW3TY.
Maren Rehder, 20.03.2011
An meinen Schwimmkursen gefällt mir z. Z. besonders, dass die Gruppen bei weitem nicht homogen sind - das bringt viel Leben
in das Training.
Die Kinder oder ihre Vorfahren bzw. Eltern kommen aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen. Ebenso bunt sind die Schwimmoutfits -
geblümte Tankinis werden mit knallrosa Schwimmmasken kombiniert - das erinnert mich schon manchmal an Kindergeburtstag oder
Fasching über das ganze Jahr. Auch knielange weite Hosen sind vertreten u. a.
In einer Gruppe reicht die Altersspanne von 5 bis zu fast 15 Jahren. Sport ist ein geeignetes Medium, um Besonderheiten zu
berücksichtigen und durch gemeinsames Tun unter "einen Hut" zu bringen. Jedenfalls besteht die Herausforderung dazu.
Erstaunlich sind die Fortschritte, die sich manchmal sehr deutlich an dem oder der einen oder anderen Teilnehmenden erkennen lassen -
Fortschritte, die veranschaulichen, wieviel Potenzial und Bildsamkeit in diesen Altersgruppen stecken und in mir eine Menge Respekt vor
den kindlichen bzw. jugendlichen Fähigkeiten auslösen. Dennoch sollte das Spielen auch einen festen Platz im Rahmen des
Trainings einnehmen. Des Weiteren hoffe ich, dass diese Individualitäten bei ihrer gleichzeitigen Verinnerlichung von allgemein
gültigen Regeln erhalten bleiben.
Maren Rehder, 09.04.2011
Sicherheitsgrundlagen beim AnfängerInnenschwimmen bilden nach der Aquapädagogik von Uwe Legahn das Training der Schreck-
reflexumkehr (Ausatmen unter Wasser in situativen Unterwassermomenten, Vermeiden von Panik, KEIN Einatmen von Wasser, Gewissheit des
Auftauchens zum Luftholen) und des sog. passiven Schwimmens, wozu Ruhe- und Entspannungshaltungen wie der sog. "Seestern", das
"Wassertreten" u. a. gehören.
Vielfältige, altersgerechte Bewegungsformen liefern den Erfahrungsspielraum für ein sicheres Wassergefühl und -verhalten.
Das Schwimmen in Rückenlage sowie das "Hundekraulen" eignen sich besonders gut für die ersten Schwimmausführungen.
Eigentlich müssten das Schwimmen in Rückenlage sowie das passive Schwimmen wesentliche Bestandteile der ersten Kinder-
Schwimmprüfungen sein. Vorbildliche Schwimmprüfungen finden sich m. E. n. in der Schweiz.
Das Umgehen mit situativen, z. T. ungeordnet wirkenden Schwimmaugenblicken in einer Gruppe fördern Selbstständigkeit,
soziales Lernen und Sicherheit im Wasser. Zu viel gewollte Ordnung fördert zwar das Techniklernen, entspricht jedoch nicht
realen Situationen, die oftmals ungeplant daherkommen.
Die altersgerechte Basis für ein Schwimmen, das sich erst später mehr an Technik orientieren will, wird gelegt.
Maren Rehder, 18.05.2011
Die Anforderungen des DSV für das Seepferdchen (Sprung vom Beckenrand, 25 m Schwimmen, Heraufholen eines Tauchringes aus
schultertiefem Wasser) garantieren nicht unbedingt sicheres Schwimmen.
Mit tiefem Wasser umgehen zu können, bedeutet kraftsparende Bewegungsformen im Wasser zu kennen, die Rückenlage genauso gut
wie die Bauchlage zu beherrschen sowie mehrere Bahnen sicher schwimmen zu können und gegebenenfalls zu Rotationen um die
Körperachsen ohne Bodenberührung in der Lage zu sein. Hinzu kommen das Vermögen des zielgerichteten Tauchens in
ca. 1,80 m Tiefe, das Ausatmen in das Wasser und das Springen mit unterschiedlichen Techniken, z. B. Fußsprung, Paket-
und Schrittsprung. Grundsätzliche Baderegeln und allgemeine Gefahren im und am Wasser sollten ebenfalls bekannt sein.
Das Schwimmabzeichen ist leider kein Garant für das Umgehenkönnen mit vielfältigen Situationen im Wasser.
Ein Schwimmtraining, das für unterschiedlichste Situationen offen und nicht schematisch orientiert ist, kann die Sicherheit
im Wasser fördern.
Maren Rehder, 30.06.2011
Bei schlechtem Sommerwetter sinkt die Laune bestimmt nicht, wenn eine Poolnudel parat ist. Daher habe ich mir hier
einige Übungen mit der Poolnudel einfallen lassen, inspiriert durch Lesen, Gucken und Ausprobieren. Auch Pilates ist mit der Poolnudel sogar zu lateinamerikanischen
Rhythmusklängen möglich - hier ein Beispiel.
Maren Rehder, 07.08.2011
In meinen Anfänger/-innen-Schwimmkursen ist mir besonders wichtig, dass das Ausatmen unter Wasser bei geöffneten Augen gelernt wird.
Dank der tollen Team-Leitung von zwei Oldies (75 J. und 88 J.) wurde mir ermöglicht vielfältige und außergewöhnliche
aquapädagogische Erfahrungen zu sammeln.
U. a. entwickelte ich zwei Spielideen, die das Sicherheitsvermögen im Wasser schulen:
1. "Seestern"-Ticker: In einer Gruppe wird ein Ticker benannt. Getickt werden können nur diejenigen, die versäumten, den "Seestern"
zu machen - ins Wasser gedrückte Kopflage, Bauch nach oben zeigend, Arme und Beine abgespreizt. Der Körper breitet sich parallel
zur Wasseroberfläche flächig aus wie ein Floß o. ä und treibt mühelos an der Oberfläche.
2. "Wellenmacher" (o. "Gegen den Strom"): Die Gruppe wird in zwei Gruppen geteilt, und diese stehen sich gegenüber. Während die eine Gruppe
brustschwimmend auf die andere zuschwimmt, macht die andere Gruppe Wellen mit den Armen und Händen. Auf dem Rückweg schwimmt diese Gruppe in
Rückenlage, z. B. im altdeutschen Rückenschwimmen. Danach erfolgt ein Rollentausch.
Zur Erhöhung der Sicherheit ist es nicht immer sinnvoll, den Schongang einzulegen - Wellen und gewolltes Chaos üben manchmal mehr!
PS: "Meine" Schwimmkinder sind oftmals daran zu erkennen, dass sie unvermittelt Badegäste im Schwimmbad ansprechen und sagen: "Du, kann ich Dir
mal was zeigen?!" Da die Antwort gar nicht erst abgewartet, sondern sogleich mit dem Vorzeigen begonnen wird, wird der eine oder andere Badegast
auf Kinder treffen, die beinahe unzählige Vorwärtsrollen im Wasser vorführen. Das hat mehrerlei Sinn: a) Rollen machen Spaß!
b) Rollen simulieren eine Situation unter Wasser, die eintreten kann, wenn jemand z. B. plötzlich ins Wasser gerät und von diesem quasi
mitgerissen wird. c) Rollen bereiten auf das Tieftauchen vor.
Beim Rollen sollen die Kinder lernen, die Augen zu öffnen und durch Ausatmen oder Gegendruckerzeugen ("dicke Backen" machen) kein Wasser in Mund
und Nase dringen zu lassen.
Ich selbst liebe am meisten das Knäuel aus Armen, Beinen, Händen und Füßen, das sich kulturen- und altersübergreifend in
mancher Schwimmstunde ergibt.
Maren Rehder, 28.09.2011 (- ergänzt am 21.10.2011 -)
In die mäanderartigen Eigenschaften des Wassers Eintauchen bedeutet den aufrechten Gang zu verlassen und einen Perspektivenwechsel eines
Organismus in der Waagerechten einzunehmen ähnlich einem Amphibium oder einem Fisch.
Als Mensch kann das Ein- und Abtauchen Distanz zwischen sich und die alltäglichen Dinge bringen, jedenfalls für einen Moment.
Eine Zeit lang "weg" zu sein, sich auszuklinken, bringt manchmal neue Horizonte hervor, eröffnet neue Blickwinkel.
Energie, die wir im Wasser lassen, verändert das Wasser und uns. Wir sind nicht dieselben wie vorher.
Da fällt mir das berühmte Zitat des altgriechischen Philosophen Heraklit (ca. 520 bis ca. 460 v. Chr. bzw. vor unserer Zeitrechnung)
ein: "Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen."
Tatsächlich mag es physikalische Untersuchungen geben, die die strukturelle Veränderung des Wassers nach z. B. Energiezufuhr oder
deren Entnahme belegen. Wasser wäre somit ein Medium analog der Knete, an das ich Negatives abgeben und von dem ich Positives aufnehmen kann.
Maren Rehder, 30.09.2011
Wenngleich mir die "Abzeichenjagd" bei meinen Schwimmkursen nicht am wichtigsten ist, sondern eher als "zwangsläufiges Nebenprodukt" abfällt,
beeindruckt mich nachhaltig, wie über die Hälfte der überwiegend 9-10-Jährigen, die regelmäßig an einem meiner Kinderschwimmkurse teilnahmen,
die Anforderungen für das DSV Gold für Jugendliche bestanden (zu den deutschen Schwimmabzeichen des DSV siehe
http://www.dsv.de/fachsparten/fitness-gesundheit/schwimmabzeichen/). Ohne größere Probleme meisterten viele die vorgeschriebene Zeit im Brustschwimmen auf 50 m.
Die erlernte Kippwende mag beschleunigend dabei mitgewirkt haben. Auch das Streckentauchen von 15 m gelang nach wenigem Üben. So konnten in dieser Gruppe insgesamt
7 Kinder abschließend mit dem DSV Gold für Jugendliche "dekoriert" werden.
Um aus einer guten Leistung im Schwimmen einen Beruf zu machen, ist sicherlich noch mehr erforderlich - ein guter 20. Platz bei großen Wettkämpfen reicht für
den ganz großen Sieg leider nicht aus, wenngleich auch so eine Leistung weit über dem Durchschnitt liegt!
Prüfungsleistungen in den gängigen Schwimmprüfungen geben auch nur einen Ausschnitt aus dem Leistungsspektrums einer Schwimmerin/eines Schwimmers wieder.
Soziale Fähigkeiten oder individuelle Schwerpunkte werden darin i. d. R. nicht berücksichtigt.
Es kommt schon mal vor, dass die von mir zu betreuende Gruppe eine Stärke von 16 Kindern unterschiedlichen Alters und Leistungsniveaus umfasst. Ein Einzeltraining
unter besonderem Berücksichtigen individueller Tendenzen muss dann zurückgestellt werden. Aber das ist das Spannende an dieser Aufgabe - es muss
einiges improvisiert werden, da nicht immer von konstanten Situationen ausgegangen werden kann.
Den Kindern gebührt nachträglich mein Glückwunsch für ihre außergewöhnliche Leistung und ihr Durchhaltevermögen!
Maren Rehder, 26.10.2011
Auch mit der Disposition zu Asthma lässt sich u. U. weiter schwimmen - wichtig ist nur der rechtzeitige Gang zu einer Medizinerin oder einem Mediziner.
Auf Chlor kann man / frau nicht unbedingt allergisch reagieren, meistens liegt eine andere Allergie als Grunddisposition vor, die auf Ähnlichkeiten
in Schwimmbadwasserzusammensetzungen trifft - dadurch wird die allergische Reaktion dann ausgelöst.
Eine Stauballergie könnte z. B. diese Grunddisposition sein. Werden vorbeugend z. B. Nasensprays mit antiallergischer Wirkung o. a. eingenommen, kann die
Allergie "in Schach" gehalten werden. Betroffene Hautstellen können vor dem Schwimmen z. B. mit Vaseline u. a. geschützt werden.
Maren Rehder, 17.12.2011
Über einige Dinge schweige ich lieber ... . Na ja, neulich fand ich jedenfalls ein paar dritte Zähne auf dem Schwimmbadgrund -
vielleicht brauchte sie jemand nicht mehr? Oder es war ein Geschenk? Vielleicht gehörten sie auch dem Herrn, der schon mal mit "Schwimmärmchen"
im Hallenbad gesichtet worden sein soll, obwohl er eigentlich schwimmen kann. Will er damit eventuell Aufmerksamkeit erregen, Zuwendung erheischen?
Ernährt sich diese zahnlose Person fortan von flüssiger Nahrung oder trinkt gar das Badewasser? Keine Ahnung. Vielleicht ist das Gebiss
auch rausgeflogen, weil dem Gebissträger bzw. der Gebissträgerin ein Schrecken widerfahren ist? Da könnte ich nun noch von skurrilen
Whirlpoolbegegnungen berichten, was ich besser lasse, sonst fliegen dem Leser / der Leserin noch unvermittelt die Zähne heraus, was ich nicht
möchte - Zahnarztbesuche können u. U. teuer sein.
Jedenfalls beherrsche ich inzwischen einigermaßen gut das Delphin-Schwimmen. Nach einer Delphin-Bahn treten hin und wieder bis dahin neutrale Badegäste
an mich heran - ob die Zähne von all denen echt sind, weiß ich allerdings nicht (jedoch gibt es auch echte Kunstzähne) - und fragen mich
nach Schwimmtechniken. Delphin-Anwärtern und -Anwärterinnen gebe ich folgenden Rat: Vorne ein Kick, wenn sich die Arme in der langen Streckung
befinden und ein Kick, wenn die Arme eines Brustschwimmers / einer Brustschwimmerin sich abdrücken bzw. bevor sie sich vor der Brust zusammenziehen wollen.
Also, auf 1 Armzyklus kommen 2 Beinschläge - beim Kraulen kommen ca. 6 Beinschläge auf 1 Armzyklus von beiden Armen beim Sprint - die lange Strecke
kommt beim Kraul schon mal mit "nur" 2 Beinschlägen auf 1 Armzyklus mit beiden Armen aus. Das ist so ähnlich wie beim Gehen an Land.
Ich bevorzuge jedoch den Vergleich Brustschwimmen und Delphin und nicht den mit dem Kraulen, weil Kraulen im Vergleich zu den beiden anderen Schwimmarten keine
Gleichzug-Bewegung darstellt. Die Arme des Brustschwimmers / der Brustschwimmerin müssen dann noch über das Wasser "fliegen" - außerdem wird
unter Führung des Kopfes eine Welle durch den Körper eingeleitet. So nähere ich mich dem Delphinschwimmen an.
Es hat mich einige Monate Zeit gekostet, ehe ich soweit war! Ich hoffe nur, dass mir bei der Überwasserphase nicht mal die Zähne erst nach vorne rausknallen
und dann durch den enormen Flugwind nach hinten wegfliegen, wenn ich in dem entsprechenden Alter bin. Von einem herumfliegenden Gebiss im Schwimmbad getroffen zu werden,
könnte unangenehme versicherungstechnische Folgen nach sich ziehen :-)
Das Abholen der Ersatzteile an der Fundstelle des Badebetriebes wäre ebenfalls peinlich, zumal ja kaum mit zahnlosem Mund gesprochen werden kann.
In jedem Fall kann man / frau mit Delphin mächtig Eindruck schinden - kleine Fehler fallen dem Laien / der Laiin nicht so auf. Einige Menschen
wissen gar nicht, dass sie Delphin-Elemente beim Schwimmen verwenden:-) Also, frisch ans Werk!
Maren Rehder, 18.12.2011
Einer unangenehmen Tatsache müssen einige Frauen unter uns noch ins Auge sehen: Das Schwimmen macht uns "männlicher"!
Wir schütten noch mehr Testosteron als sonst aus, erkennbar z. B. an einem Bartansatz, der SO vor dem Schwimmbadbesuch nicht vorhanden war!
Also, einige Frauen gehen weiblicher ins Bad, als sie nachher herauskommen. Das ist wahrlich kein Scherz!
Daher spricht dieser Sport oftmals auch sehr sanfte Herren an, die sich natürlich davon eine Bissfähigkeit erhoffen, die ihnen von "Mutter Natur"
irgendwie versagt geblieben zu sein scheint. Der Mann mit den Schwimmflügeln könnte u. U. so ein "Typ" sein. Gut, dass es das Schwimmen gibt!
Egal, dieser Sport verbindet ALLE über das nasse Element und nimmt uns wie in einer großen Familie auf. Nur Weihnachten müssen wir
zu Hause bleiben, da haben die meisten Schwimmhallen leider zu.
Maren Rehder, 19.12.2011
Im neuen Jahr dann eventuell mehr zu dem äußerst sensiblen Thema "Fußpilz" - alles halb so wild - auch darüber kann "man" Leute,
meistens von unten bzw. hinten kennenlernen. Ich habe mir sagen lassen, dass Fußpilz-Trägerinnen und -Träger eine kleine eingeschworene
Gemeinde innerhalb des Schwimmbeckens bilden, die sich wortlos verständigen, sozusagen über Empathie. Die meisten von ihnen stehen zu ihrem "Pilz",
was ihnen eine besondere Note an Charakterstärke verleiht. Fußpilze machen zudem charismatisch.
Auch haben einige so Gesegnete nichts dagegen, diese Pilzkultur mit anderen zu teilen, und sie an andere weiterzugeben.
Das finde ich prima und befruchtet das gemeinsame Schwimmerlebnis. Was die einen schon haben, geben sie freimütig und selbstlos an andere ab - das ist
Solidarität pur! Das Sozialwesen wächst und lebt und breitet sich auf diese Weise aus. Wäre doch bloß alles auf dieser Welt so für alle da!
Maren Rehder, 20.12.2011
Also, ich bin jetzt schon froh, wenn die Wasserkrise in Kiel vorbei ist! Um Kiel herum ist im Vergleich mit anderen Städten relativ viel Wasser - in Kiel "drin"
leider demnächst immer weniger. Es wurden undichte Stellen in der Universitätsschwimmhalle entdeckt (was mich eigentlich gar nicht so sehr wundert),
wo Wasser rausläuft, das eigentlich "drin" bleiben soll (das Wasser benimmt sich hier wie ein unartiges Kind) - das sollen pro Tag 20.000 (!) Liter sein und zwar mit
Chlor. Erst hatte ich einen meiner Schwimmschüler in Verdacht, der sich am Ende einer Stunde locker über den Beckenrand hängte und sagte, dass
er das Wasser trinken würde - nähere Untersuchungen bewiesen jedoch die Unschuld des fast 9-Jährigen.
Nun sollen undichte Dehnungsfugen (2 oder 3 davon) die Ursache für den enormen Wasserverlust sein (Schilda ist überall!). Die Fugen
dehnten sich so weit, bis Spalte entstanden, und nun rinnt dort das kühle, gechlorte Nass hindurch - so entsteht ein Schwimmbad "unter" dem Bad!
Wo sollen meine Schwimmkumpels und ich nur bleiben?
Na ja, für die Bundeswehr und andere solide Vereine wird jetzt eine Schwimmer/-innenbahn in den großzügigen Lehrschwimmbecken eingebaut (Nein, gegraben
wird da nich - es wird nur so getan, als wäre es an der tiefsten Stelle des Le(e)hrschwimmbeckens quasi genauso tief wie im normalen Erwachsenen-Schwimmbecken.)
Dieser Effekt wird verstärkt, wenn man sich beim Schwimmen bemüht, nicht mit dem Bauch auf Grund zu stoßen - tauchen geht da auch noch prima, weil
einige Leute unter diesen neuen Schwimmer/-innenbahnen auch noch ihre Tauchkurse durchführen sollen. Bitte wundert Euch nicht, wenn Euch mal eine Sauerstoffflasche
eines Tauchers von unten ans Schienbein haut. Wir schwimmen effizient unter- und übereinander, so ´ne Art Sandwich-Prinzip - bitte gleich in die neue Hallenordnung
aufnehmen! Ab bald wird nicht nur nebeneinander, sondern auch übereinander geschwommen.
Hoffen kann ich nur, dass sich die Fußpilz-Leute rar machen, denn bei der Tuchfühlung, die da ab dem 18. Februar auf uns zukommt, hat der Pilz eine
vervielfachte Chance auf Ausbreitung - nein, Danke - non merci!
Positiv zu sehen ist, dass sich nun wieder Leute gemeinsam einen Raum teilen müssen, die sich sonst nicht mal gemeinsam auf `ne Bank setzen würden.
Verwunderlich ist zudem nicht, wenn in Kiel Trockenschwimmende mit Badekappe und Schwimmbrille auf freiem Feld gesichtet werden - in der Not wird der Mensch
erfinderisch. Trocken zum Bus zu schwimmen ist bald eine ideenreiche Variante zum normalen Gehen oder Rennen. Prima, ich freue mich schon drauf - habe meinen
Neoprenanzug schon mal mit Spikes ausgestattet, damit ich mich im Gedränge wirkungsvoller behaupten kann.
Ach ja, wahrscheinlich können somit sämtliche Single-Börsen dicht machen - in Kiel ist man / frau beim Schwimmen demnächst nie mehr allein!
Maren Rehder, 04.02.2012
Tauchen und Schwimmen gehören zusammen! Wer sich unter Wasser auskennt, kennt sich auch über Wasser aus!
Wer das Wasser um seinen ganzen Körper herum erlebt, kann ein richtiges Gespür dafür entwickeln.
Wenn das Wasser alle Poren und Ritzen benetzt und umhüllt, ist ein perfekter Kontakt mit diesem Element gelungen.
Schwerelosigkeit, Schweben, Gleiten und sich unter Wasser vor- oder rückwärts bewegen, ist die Basis für Schwimmen!
Schwimmen sollte für alle da sein, egal, ob schnell oder langsam, arm oder reich, klein oder groß!
Maren Rehder, 27.04.2012
Neulich bin ich mal wieder vom 3er gesprungen. Den Bogen habe ich inzwischen raus - nach vorne schauen, ein Schritt und schon
bin ich unten. Zum Glück hat die Schwerkraft auch mitgespielt - Gesetze der Physik haben mich in Windeseile in das kühle
Nass transportiert. Vom 5er geht das wohl nicht ganz so schnell, es sei denn, ich würde vor dem Sprung noch an Körpergewicht
zulegen. Dann könnte es sein, dass ich mal genauso schnell vom 5er wie vom 3er komme:-)
An Panik war diesmal gar nicht zu "denken", im Gegenteil - minutenlang verweilte ich noch an der Kante des Sprungbrettes, weil ich einigen
Schwimmenden natürlich nicht zu nahe kommen wollte, die unter dem Brett schwammen - auch konnte ich mich da oben noch locker unterhalten,
derweil mich nur ein Hauch vom Abgrund trennte. Prima! Da fiel mir doch gleich ein, dass ich vor 2 Jahren vor Panik den Sprungturm kaum betreten
konnte. Dann war da dieser kleine Junge, der zitternd vor mir auf dem mächtigen Brett stand und auf den sämtliche umherstehende Menschen
mit scheinbar beruhigenden und mutmachenden Worten einredeten, während mir erst durch dieses lange Warten und Miterlebenmüssen diese angebliche
Gefahr immer bewusster wurde. Es hat mich einige Wochen gekostet, diese Sprungblockade zu lockern. U. a. bin ich an den Ort gefahren, wo ich problemlos
als Kind unzählige Male herunter gesprungen war. Wahrscheinlich hing das ganze doch mit dem Aufzug zusammen, in dem ich einmal stecken geblieben bin.
Seltsamerweise benutze ich Aufzüge jedoch nach wie vor, wenngleich mir ein Techniker erzählte, der mich damals aus dem stehen gebliebenen
Lift befreit hatte, dass er selbst nach Feierabend keinen "Fahrstuhl" mehr benutzen würde, weil dann das Risiko größer wäre,
technisches Personal für den Notfall nicht erreichen zu können.
Glücklicherweise gelang es mir, VOR Feierabend mit dem Aufzug stecken zu bleiben.
Was ich bis dato verschwiegen hatte: Ich war gut ausgerüstet, denn ich hatte den ganzen Betriebs-Wein dabei.
Maren Rehder, 28.04.2012
Oft erinnert mich "Schwimmen" an Kunst! Kunst sollte eine individuelle Angelegenheit sein. Ein gutes Kunststudium regt dazu an, nicht genormte, sondern
individuelle Wege zu beschreiten. So kommt es mir beispielsweise beim "Skullen" vor: Die klassischen Schwimmtechniken werden beim Skullen verlassen.
Es geht um eine Art informelle Fortbewegung, die durch Hin- und Herbewegen der Hände erreicht werden soll. Das Wassergefühl wird dabei besonders
angesprochen, und es wird erfahren, dass es neben den klassischen Schwimmstilen noch Alternativen gibt, die Fortbewegung im Wasser zwar zum Ziel haben,
dieses Ziel aber ganz unterschiedlich erlangen. Es sind eher suchende Bewegungen, die sich ergeben durch den spontanen Dialog mit dem Wasser.
Ein Künstler / eine Künstlerin geht ähnlich vor, wenn er / sie eine Skizze oder einen Entwurf anfertigt.
"Fertig" im eigentlichen Sinne ist ein Künstler / eine Künstlerin dabei nie. Die Unfertigkeit muss ausgehalten werden - das ist analog dazu "Skullen".
Häufig wird Skullen als das Wedeln von "Achten" im Wasser mit den Händen beschrieben, im Grunde sind es jedoch recht vielfältige Wedelbewegungen,
die keinem Gesetz unterliegen und einen Körper mit Körperspannung auf ungewöhnliche Weise vorantreiben.
So kann mit gestreckten Beinen voran geschwommen werden in Rückenlage, wenn die Hände seitlich "skullen". Auch kann der Vortrieb in Kopfhöhe
durch seitlich schiebende Bewegungen der Arme und Hände bei voran gehaltenen Füßen und Beinen erfolgen.
In der Kunst ist es ähnlich - ein Künstler soll nicht einen auswendig gelernten Pfad beschreiten, sondern seinen eigenen Weg gehen.
Oft habe ich mir die schwimmenden und schwebenden Körper im Wasser als zwei- oder dreidimensionale Kunstwerke vorgestellt.
Es ist einfach faszinierend! Ein besonderes ästhetisches Erlebnis bieten TaucherInnen mit ihren langen, farbigen Tauchflossen, die sich in wallender
Form absolut harmonisch und im Einklang mit dem Wasser mittels Kraulbeinschlag fortbewegen - für Hektik liefert dieses Medium kaum Raum.
Als Außenstehende gewinne ich den Eindruck, einem grazilen Spiel mit dem Element "Wasser" zuschauen zu dürfen, wenn sich diese farbigen Flossen
wie leuchtende Segel unter Wasser biegen und für einen sensiblen Vortrieb sorgen.
Das ist Kunst!
Maren Rehder, 30.04.2012
Dass Sportler/innen durch sportlichen Drill nicht die Lust an ihrem Sport verlieren, finde ich sehr wichtig! Auf meinen Schwimmbahnen haben sich schon
manchmal talentierte Schwimmer/innen eingefunden, die keine Stoppuhr mehr "sehen" konnten und lauthals protestierten, wenn ich ihre Zeit messen wollte.
Diese Teilnehmenden stießen oftmals von anderen Gruppen zu mir, wo sie offenbar zu sehr gegen eigene Wünsche parieren mussten.
Die Freude an der Sache soll den Aktiven nach Möglichkeit erhalten bleiben. Sicherlich sind der Preis für den Erfolg harte Arbeit, Verzicht
und Disziplin. Wer sich diesem Schema gerne anpasst, soll dieses selbstverständlich tun können. Wem dieses Schema nicht so zusagt, soll dieses
ebenfalls ohne Naserümpfen ausleben dürfen, wenn dadurch die Freude an dieser Freizeitaktivität erhalten bleibt.
Maren Rehder, 06.05.2012
Schwimmen unterrichte ich leidenschaftlich gerne - von den Kindern lerne ich immer wieder etwas Neues dazu - sie hoffentlich auch von mir.
In den Schwimmstunden ergeben sich meistens Mischungen aus Planung und viel Spontaneität - das sind Freude, aber auch "Leid" so mancher Schwimm-
stunde, die aus sehr heterogenen Gruppen besteht. Wenn die Anzahl der Teilnehmenden mit höchstens 8 Teilnehmenden überschaubar bleibt, ergeben
sich spannende Erlebnisse und Entdeckungen im und mit dem Wasser.
Neulich zeigten sich ganz spontan große Fortschritte bei einem Jungen, der noch nicht das "Seepferdchen" erworben hat und im Vorschulalter ist.
Dass ich mit diesem Kind überhaupt zu tun bekam, hing mit der momentanen Umstrukturierung des Schwimmunterrichts wegen einer vorübergehend
geschlossenen Schwimmhalle zusammen.
Von sich aus äußerte der Junge den Wunsch, im Nichtschwimmer tauchen zu wollen, traute sich jedoch nicht, sich mit dem Kopf voran nach unten zu
bewegen. Meine Tauchringe lagen in weiter Ferne, und so warf ich einfach meine Schwimmbrille ins Wasser und ließ diese auf den Beckenboden
sinken. Zuerst gelang es ihm gar nicht an die Schwimmbrille zu kommen. Dann machten wir ein paar Gleitübungen mit Abstoßen vom Beckenrand - erst
über Wasser, dann unter Wasser - der Kopf sollte so dann mit den vorgestreckten Armen voran unter Wasser kommen. Der etwas ältere Bruder
des Jungen war inzwischen auch "aufgetaucht" und zeigte, wie er mit dem Kopf nach vorne problemlos die Schwimmbrille vom Beckenboden herauf holen
konnte. Nach ca. 3 weiteren Versuchen gelang es dann auch dem Jüngeren die Schwimmbrille zu holen, und er wiederholte dieses sogar in einem
tieferen Beckenbereich. Zuletzt haben wir sogar noch versucht, Purzelbäume im Wasser zu schlagen.
Als die Oma auf beide Jungen wartete, die übrigens beide biblische Vornamen tragen wie "Petrus und Paulus", wollten diese gar nicht nach Hause
gehen, ignorierten die Großmutter und blieben noch während eines Schwimmunterrichts unter anderer Leitung - ich hatte schon wieder anderes
zu tun - weiterhin im Wasser.
Maren Rehder, 09.05.2012
PS: Wie aus Wasser Wein gemacht werden kann oder wie man über das Wasser wandelt, ist nicht Gegenstand meines Unterrichts!
Für diese Art des Spezialtrainings stehen andere Einrichtungen zur Verfügung, die u. a. an dem Kreuz zu erkennen sind, das sie
oftmals auf ihrem Dach tragen:-)
Maren Rehder, 10.05.2012
Warum "Schmetterling" so und nicht "Delfin" genannt wird, ist mir ein Rätsel. Ursprünglich beschrieb "Schmetterling" die Armbewegung
im Gleichzug der Schmetterling-Stilart, dazu wurden jedoch "Brustbeine" gemacht. Mir leuchtet ein, dass diese synchronen und symmetrischen Be-
wegungen der Arme und Beine mit weit nach außen führenden Armen an die 4 Flügel eines Schmetterlings erinnern. Wieso aber, seit
Schließung der Beine und Delfin-Kick in der Hüfte sowie Abwärtsschlag der geschlossenen und gestreckten Füße nun immer
noch häufig "Schmetterling" gesagt wird, ist mir nicht ganz klar. Folge: Ich nenne die Schmetterling-Armbewegung mit Delfin-Beinschlag ganz
einfach "Delfin". Siehe hier noch ein schönes Video: http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=nDFQ5ccLQJ0.
Maren Rehder, 07.06.2012
Mein Schweigen hat Gründe - es liegen 6 Monate "Geh weg! Hau ab! Was willst Du von mir!" hinter mir. Tja, was das alles mit "Schwimmen" zu tun hat,
können nur diejenigen beantworten, die "Geh weg! Hau ab! Was willst Du von mir!" organisierten.
Jedenfalls sitze ich nun auf einem Papierberg und auf einer C-Trainerinnen-Lizenz!
Nach getaner Arbeit hoffe ich auf einen schönen Herbst
und Winter - trotz Klimaerwärmung - mit Tee, Wollmützen, langen Spaziergängen, frischer Luft und mit mindestens einem guten Buch etc.
Maren Rehder, 11.09.2012
Seitdem mir das Buch von Dr. Thomas Wessinghage, Markus Ryffel und Valtentin Belz mit dem Titel "Aqua-Fit", München 2005, geschenkt wurde,
schaue ich öfter über den "Tellerrand". Das Aqua-Jogging ergänzt ein Training an Land perfekt und ist dazu extrem gelenkschonend!
Wirbelsäulenprobleme verschwinden meistens, wenn ganz kleine Schritte mit hoher Frequenz im Wasser ausgeführt werden.
Auch durch das Trainer/innenseminar angeregt, laufe ich ca. 40 x 25 m oder 20 x 50 m an einem Tag in der Woche im Wasser. Die ersten Bahnen jogge
ich mit Unterstützung eines Aqua-Jogging-Gürtels, die letzten 2-4 Bahnen absolviere ich ohne Auftriebshilfe im Wasser.
Meistens kann ich danach besser schwimmen, und mein Lauftraining an Land hat sich ebenso verbessert.
Siehe hier ein Lehrfilm mit etwas Werbung (sorry!) - http://www.youtube.com/watch?v=4YeKkR78lbE&feature=related.
Aqua-Jogging liebe ich ohne viel "Schnick-Schnack" d. h. ohne überflüssige Unterhaltungsaspekte und Amusement.
Schwimmen und Bewegen im Wasser sind m. E. n. ganzheitlich orientiert - eine betriebswirtschaftlich effiziente Planung passt nur z. T. dazu!
Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit halten sich nicht an betriebswirtschaftliche Prinzipien!
BWL zerstört ganzheitliche Bewegungsansätze! Möglichst viele Leute mit wenig Personal auf engstem Raum zu trainieren, ist absolut unpädagogisch!!!
Das macht auch keinen Spaß!!!
Bewegung im Wasser hat etwas mit Fühlen zu tun und nicht mit "klingender Kasse" und Planabspulen!!!
Für sinnliche Erfahrungen braucht man Zeit und Raum und Geduld bzw. etwas Muße! Solche Erfahrungswelten unterliegen nicht der Dressur!
Maren Rehder, 07.10.2012
Eine Pädagogik, die sich mit Wohlwollen an ihrer Klientel orientiert, kann oftmals effizienter und wesensgemäßer ein Ziel erreichen als eine Lehre,
die schematisch vorgeht und zwecks Zielerreichung den Willen ihrer Klientel bricht - bewiesen wurde das z. B. durch Monty Roberts bei seinem Umgang mit Pferden.
Kritische Stimmen werfen jedoch auch Monty Roberts eine Pädagogik vor, die eine List verwendet, um den Willen der Pferde zu manipulieren - Roberts verbirgt
danach sein Vorgehen einfach subtiler im Vergleich mit schulmeisterlichen Lehrmethoden. Mag sein, dass an diesem Vorwurf etwas dran ist, denn schließlich
verfolgt auch Roberts das Ziel, das Fluchttier "Equus" gefügig zu machen und sich zu unterwerfen. Strittig ist, ob dabei Formen psychischer Gewalt im Spiel sind.
Pädagogik, Schwimmen und BWL haben etwas mit unserem Zeitverständnis zu tun - dazu fand ich einen interessanten Beitrag hier http://www.youtube.com/watch?v=Ml-raBZtygk.
Fritz Reheis schrieb schon vor Jahren ein Buch mit dem Titel "Die Kreativität der Langsamkeit: Neuer Wohlstand durch Entschleunigung" - Qualität unterliegt
offenbar individuellen Deutungsmustern, die jedoch ihrerseits auf ihren Einflussradius verwiesen d. h. von offiziellen Deutungsmustern abhängig sind.
Maren Rehder, 28.11.2012
An Kindern mag ich besonders, dass sie so "unverdorben" sind und sich noch nicht so gut verstellen, wie Erwachsene dieses oft tun.
Eine Ausnahme besteht, wenn Kinder um ihre Kindheit oder einen Teil davon - in Abhängigkeit von soziokulturellen Faktoren - "gebracht" werden.
Vor geschätzten 20 Jahren kam ein Schwarm von Straßenkindern inmitten eines großen Platzes einer großen Stadt
im Herzen Südeuropas auf mich zu. Von allen Richtungen schienen ca. 20 Kinder auf mich einzureden. Ein Mädchen schaute mich
mit großen dunkelbraunen Augen an, hielt mir ein Pappschild, auf dem etwas geschrieben stand, in Brusthöhe über den Anorak.
Ich konnte nicht sehen, was ihre Hände unter diesem Schild taten.
Sie "fesselte" so meine Aufmerksamkeit.
Von beinahe allen Seiten spürte ich ein Rupfen und Zupfen.
Dann zogen sich die Kinder auf einmal zurück. Ihr durchschnittliches Alter schätzte ich auf 6 bis 7 Jahre.
Meine Mitreisende fragte mich plötzlich, ob meine Geldbörse noch in meiner verschlossenen Brusttasche wäre.
Im ersten Moment empfand ich diese Frage als absolut überflüssig, da ich meinte, gemerkt haben zu müssen, wenn etwas abhanden
gekommen wäre.
Zu meiner Verblüffung stellte ich fest, dass meine Brusttasche leider leer war. Fragend schaute ich mich nach meiner Mitreisenden um.
Dann sahen wir, wie die Kinder in der Ferne mit meinem pinkfarbenen Brustbeutel auf dem Platz spielten, ihn scheinbar höhnisch in die Luft warfen, wie
dieser in der Sonne geradezu leuchtete. Schließlich liefen die Kinder lachend fort. Das Geld (Reisegeld i. H. v. 400 DM) war an meinem 2. Urlaubstag
weg. Zum Glück hatte ich an anderer Stelle meines Anoraks die Rückfahrkarte deponiert. Die Freundschaft war futsch, und ich fuhr am
nächsten Tag in Richtung Heimat zurück. Im Zug dachte ich über die vielen Kinderaugen nach, wie sie mich getäuscht haben,
wie enttäuscht ich damals war!
Viele Jahre später stellte ich fest, dass mich diese Kinder etwas Wichtiges gelehrt hatten.
Anläßlich einer anderen Reise in eine große Stadt Südeuropas begegnete mir die Technik des Trickdiebstahls zum zweiten Mal.
Diesmal ließ ich mich nicht einlullen.
Einer Trickdiebin, die bereits die Hand in meinem Portemonnaie hatte, drehte ich geschwind den Arm um und zog ihr sodann mehrere Geldscheine
aus dem Ärmel.
Auch sie hatte versucht, meine Aufmerksamkeit abzulenken, was mich in Erinnerung an Trickdiebstahl Nr. 1 misstrauisch gestimmt hatte, redete
mit beinahe hypnotisierendem Blick auf mich ein, während ihre Hände in meinem Portemonnaie versuchten, ein Eigenleben zu entfalten.
Nur aufgrund der ersten Erfahrung konnte ich diese Trickdiebin vorzeitig entlarven. Sie lief laut schreiend davon, und ich blieb mit einer
Hand voller gestohlener Geldscheine zurück.
Diesmal trug mir mein Handeln einen empört vorwurfsvollen Blick meiner damaligen Reisebegleitung ein, so als wenn ICH etwas Schlimmes getan hätte!
Wäre Polizei in der Nähe gewesen, hätte sie vermutlich versucht, mir den "Schwarzen Peter" zu zuschieben, da sich die Diebin plötzlich
wie ein Opfer benommen hatte - ich hielt vollkommen erstaunt die Beute dieser Dame in meinen Händen.
So hat etwas Schlechtes etwas Gutes zur Folge! Aus dem ersten Trickdiebstahl hatte ich mit Erfolg lernen können und nicht nur Lehrgeld bezahlt!
Unter Kindheit verstehe ich aber, dass Kinder sehr ehrlich sind, sie sagen, was sie meinen - sogar unverblümt und bisweilen verletztend.
So fragte ich eine meiner Schwimmschülerinnen vor etlichen Monaten - ein Mädchen mit Migrationshintergrund (Iran) im Alter von 6 Jahren - ob sie
gerne zum Schwimmen käme.
Ihre Antwort, die mir ein Schmunzeln bescherte, lautete: "Manchmal!"
Ich fand diese Antwort sehr ehrlich und mutig! So antwortet halt ein "Original"!
Maren Rehder, 03.12.2012
Ich scheine an meinem eigenen Ast zu sägen (mehr oder weniger erledigt das die Zeit allerdings bei den meisten von uns ;-) - jetzt schicken mir schon
beinahe 12-Jährige neben guten Wünschen zum neuen Jahr ihre selbst erstellten Schwimmpläne nach Hause, die sie fleißig in der Zeit zwischen
den Jahren abgeschwommen sind. Andere halten sich den Schoko-Trüffel-Bauch und hängen faul im Sessel ab! Ich scheine bald überflüssig zu sein!
Zugegebenerweise orientierte sich der mir zu Gesicht gekommene Plan jedoch sehr nahe an meinen eigenen Plänen - aber meine Nachfolge scheint bereits
gefunden zu sein - prima! Ich hoffte, bei der "Gegenseite" dann doch noch mit meinem geheimen "Möhrensuppen-Rezept" zu punkten, denn diese Möhrensuppe
verleiht Kraft und innere Stärke, daher habe ich sie auch nicht auf meiner Webseite veröffentlicht, weil diese der absolute "Brüller" ist, nahe am
"Bio-Doping", wenn es so etwas überhaupt gibt, frei von Chemie, aber oder vielleicht gerade deshalb extrem knackig und enorm günstig in der Herstellung!
Wenn meine Schwimmpläne schon nichts mehr bringen und sich bereits Kinder selbst Pläne erstellen, in denen sie z. B. "2 Bahnen wie Meerjungfrauen
schwimmen", sollte ich mich allmählich einem anderen Genre zuwenden.
Ansonsten ist aber alles gut verlaufen, kein Frontalzusammenstoß am Neujahrsmorgen auf der 25-m-Bahn (wenn auch klar ist, dass einigen die Orientierung
noch etwas Mühe bereiten kann), kein Zahnersatz auf dem Beckenboden und auch niemand, der unbedingt eine Person zum Üben von Befreiungsgriffen sucht ...
eigentlich hoffe ich, dass es so bleibt und zwar das gesamte Jahr über! Schööön NORMAL!
Maren Rehder, 13.01.2013
PS: Das Möhrensuppen-Rezept widme ich hiermit übrigens dem kleinen Zuchthasen, den ich aus Sicherheitsgründen vor einigen Jahren eigenhändig
(zusammen mit einem mir unbekannten Spaziergänger) an einem Sonntagnachmittag im Schrevenpark eingefangen habe und der dann ein gemütliches
Plätzchen im Tierheim fand und nicht im Magen einer Anaconda landete, wie mir einige weismachen wollten!
Schade, dass bei der spontanen Einfangaktion des vierbeinigen Hopplers das ursprünglich weiße Oberhemd des mir unbekannten "Hasenretters" eher die
Farben Grün, Braun und auch leider Gelb angenommen hatte. Das lag vielleicht mit daran, dass das Tier offenbar eher auf Männerstimmen fixiert
war (vielleicht stammte er aus dem Besitz eines Herrchens - vielleicht handelte es sich auch um eine Häsin...?), was mich wiederum bewogen hatte, den
von mir benachrichtigten Herrn von der Feuerwehr ("Wir haben ihn jetzt!") vorsorglich bei seiner Entgegennahme des "Mümmelmanns" zu warnen, weil auch
dieser ja eine Männerstimme hatte.
Schließlich verschwand das Tier dann wohl behalten in dem mitgebrachten Katzenkäfig (ich hatte mich übrigens mit für den Hasen völlig
reizlosen Karotten versehen gehabt, einem Pappkarton, Handschuhen, einem Seil zum Zubinden des Kartons und einem Riesen-Handy) - "wir" atmeten erst einmal alle auf.
Das war geschafft - der Herr von der Feuerwehr antwortete auf Fragen, wo er das Tier denn nun hinfahren würde, scherzhaft, dass sie alle noch nichts zu Abend
gegessen hätten - aber nein, natürlich saß oder lag das Häschen später sicher im Tierheim, wie mir am folgenden Tag bestätigt wurde.
Ob der Hase oder die Häsin heute noch lebt, weiß ich nicht - vielleicht hoppelt er oder sie auch bereits erneut in einem Park herum, ... .
An dieser Stelle, wenn auch nicht ganz passend, füge ich für Interessierte eine Bastelanleitung für ein Papierschiff ein.
Also, ich mag sie, die schwarzen Haare, die ich häufig in Gaarden sehe - ich mag diesen Stadtteil, weil er lebt... .
Ich vermisse z. B. die schwarzen Haare von "Eva" Langmaack in der Schwimmhalle Gaarden.
Ihr Schwimmtraining besaß eine eigene Note - ihren Trainingsansatz finde ich mehr als interessant - Synchronschwimmen, Ballett, Kunst, Technik und Schwimmen
unter einen Hut bringen - das können nicht viele mit so einem Gespür vermitteln. Technik ist die Grundlage von Schnelligkeit!
Wie kann es eigentlich sein, dass die einstige Co-Trainerin der Bulgarischen Nationalmannschaft im Synchronschwimmen in Kiel offenbar kein echtes Zuhause fand?
Maren Rehder, 15.01.2013
BWL im Sport - darum kommen wir offenbar nicht herum, aber nicht alles lässt sich auf Marktprinzipien reduzíeren. Es ist nicht nur eine Frage der
Ethik, sich als Schwimmtrainerin (Intrinsisch motiviert!) mit Rettungsschwimmen zu befassen, sondern auch eine Vorschrift. Vorschriften verlangen oftmals Leistungen
bzw. Sachkompetenz ab. Mag sein, dass durch derartige Regelungen einigen der Zugang zu einer Tätigkeit am Beckenrand erschwert wird, allerdings sind solche
"Hürden" verstehbar.
Meine bisher schwierigsten Aktionen bestanden darin, Kinder von einem Kopfsprung ins Nichtschwimmer abzuhalten, und einmal hatte ich es mit einem lebensgefährlichen
Erstickungsanfall bei einem Kind zu tun bekommen, den ich zunächst fälschlich als Asthmaanfall einstufte. Speisereste blockierten die Luftröhre
bei einem Mädchen, das sich dann zum Glück übergeben und sich somit die Blockade gelöst hatte.
Hätte sich dieses nicht so ereignet, wäre das Kind vermutlich unter meinen Augen erstickt. Aufgrund meiner Kenntnisse in Erste Hilfe hatte ich die obere Kleidung
gelockert und beruhigend auf das Kind eingesprochen, mehr wusste ich in der Situation zunächst nicht zu tun. Auch wollte ich mich langsam mit dem Mädchen in
einen sauerstoffreichen Bereich begeben. Inzwischen rief ich mir in Erinnerung, was bei einem Erstickungsanfall zu tun wäre. Dass sich das Kind dann an Ort
und Stelle erbrach, war ein großes Glück gewesen!
Maren Rehder, 18.01.2013
Du kannst nicht verhindern, dass die Vögel der Besorgnis über deinen Kopf fliegen. Aber Du kannst verhindern, dass sie sich in deinem Kopf ein Nest bauen.
(alte chinesische Weisheit)
Maren Rehder, 26.03.2013
Nur ein bestimmter "Typ" von Sportler(inne)n "bedarf" der Demütigung oder Frustration, um darüber zu Höchstleistungen "angespornt" zu werden.
Im Grunde gehören solche Methoden jedoch in den "Giftschrank der Pädagogik"!
Der Hirnforscher Gerald Hüther hält Belohnungen aber für ebenso manipulativ wie Bestrafungen, da die Menschen im Grunde über externen Druck
und Angst (vor Strafe oder davor, die Belohnung nicht zu erhalten), m. a. W. über negative Vehikel zu einer Leistung o. a. "bewegt" werden sollen.
Dahinter steckt ein eigentlich überholtes Menschenbild, nämlich, dass Menschen nur extrinsisch und über Druck "funktionieren".
Mit dieser Unterstellung wird die (wohlwollende) Annahme, dass Menschen aus eigener Initiative zu positiver Eigensteuerung in der Lage sind, prinzipiell negiert.
Mag sein, dass sich somit auch "talentierte" Sportler/innen dann einem anderen Sujet zuwenden - übrig bleiben oftmals solche, die ihre Individualität
weitgehend einer Fremdsteuerung übereigneten oder solche, die durch Selbsttätigkeit schwerer motivierbar sind.
Maren Rehder, 29.03.2013
Anbei ein mögliches Beispiel für "Fremdsteuerung":
:-)http://www.youtube.com/watch?v=_IfK99xoRiQ(-;
Maren Rehder, 09.04.2013
Sehr freute ich mich über die Teilnahme an den Sommerwettkämpfen von einer meiner ehemaligen Schwimmschülerinnen (Jg. 2002), die vor ca. einem
guten Jahr von "meiner" damaligen breiten- UND wettkampfsportlich orientierten, heterogenen Trainingsgruppe zu einem anderen Verein mit besserer
Wettkampfförderung wechselte! Dass diese Schwimmerin auch noch auf 50 m Brust den 1. Platz (ich hatte ihr dabei noch bewundernd zugeschaut) mit
einer Zeit von 00:52,43 Min. belegte, möchte ich an dieser Stelle mit Glückwünschen für diese ausgezeichnete Leistung an diese Schwimmerin
dokumentieren! Auch für ihre Courage und Willensstärke zolle ich ihr höchste Anerkennung!
Zudem zeigt es mir, dass aus heterogenen Gruppen in der Folge und in Kooperation mit einem leistungsorientierten Training durchaus Erfolge hervorgehen.
Lust und Freude sollten durch das Training nie verloren gehen, sondern gefördert werden!
Wie ich erfuhr, sind die zur Verfügung stehenden Wassereinheiten im jetzigen Training der Erstplazierten (3 Std./Woche an 2 Tagen) in etwa genauso viele,
wie sie im früheren Vereinstraining möglich gewesen wären, also, diese formalen Bedingungen sind quasi paritätisch.
Auch andere potenzielle Wettkampfkandidat(inn)en befanden sich auf meiner damaligen Schwimmbahn - ich wünsche auch diesen eine Förderung
entsprechend ihren Talenten, Leistungen und persönlichen Zielen!
PS: Anbei einige Zitate aus Gerald Hüther, Uli Hauser, Jedes Kind ist hoch begabt. Die angeborenen Talente unserer Kinder und was wir aus ihnen machen,
9. Auflage, München 2012:
"... Wenn Kinder früh lernen, dass sie nicht gestalten, sondern nur konsumieren können, hat das etwas Demütigendes. ... Wir sind mit dem
Computer in der Lage, fast jede Bewegung zu simulieren. Und gleichzeitig lesen wir in der Zeitung, dass immer weniger Kinder schwimmen können. Wer
zwischen sechs und zwölf Jahren nicht das Schwimmen lernt, hat es später schwer. ..." (S. 141)
" ... Es wird von uns verlangt, dass wir die uns eigene Lerngeschwindigkeit nicht ernst nehmen: Wir haben uns in das zu fügen, was andere vorgeben.
Fehler, die wir machen, führen dazu, dass wir hoffnungslos in Rückstand geraten, weil andere schneller sind, nicht warten wollen oder können.
So vergeht die Lust am Lernen. Der Zwang zur Leistung verleidet diese Urlust, mit der wir alle auf die Welt gekommen sind. ..." (S. 153)
"... Deshalb sind die Zerstörung des kindlichen Urvertrauens und Angstmacherei das Schlimmste, was man Kindern antun kann. ..." (S. 155)
"... Wir müssten doch alle wissen, dass man Kindern mit Disziplinierungsmaßnahmen, mit Bestrafungen und Belohnungen keine Disziplin beibringen
kann, sondern lediglich Gehorsam. Den aber brauchen wir in Deutschland nicht noch einmal. ..." (S. 158)
"... Für Soziologen hat sich vor allem der Narzissmus zu einem gesellschaftlichen Phänomen entwickelt. Die Selbstbezogenheit nimmt zu. ...
Die Medien sind ohne Pause auf der Suche nach Superlativen. Super-Sängern, Super-Tänzern, Super-Talenten: Spieglein, Spieglein an der
Wand, wer ist der Tollste in diesem Land? Es geht darum, für sich das Beste aus allem herauszuholen und mitzunehmen, was man kriegen kann. ...
Wir sind dem Terror eines "Aufmerksamkeitsregimes" ausgeliefert, wie der Leipziger Philosoph Christoph Türcke sagt. Einer dauererregten Gesellschaft,
die uns Sensationen nur noch um die Ohren haut. In der wir kaum einen Gedanken fassen, der nicht gleich vom nächsten überholt wird. Die heutige
Generation hat dreimal so viel Informationen zu verarbeiten wie die Menschen vor 30 Jahren. ...
Wer den ganzen Tag mit Eindrücken bombardiert wird, schaltet irgendwann ab. Wenn er dazu überhaupt noch in der Lage ist.
Auf der Strecke bleibt unser Mitgefühl. Die Fähigkeit zur Empathie lässt dramatisch nach. ...
Psychologen erklären das mangelnde Mitgefühl vor allem mit der Bilderflut: Zu viel gesehen. ...
Wir alle entwickeln Strategien, um uns das Mitgefühl abzugewöhnen.
Wir erleben in der Schule, an der Universität und in der Wirtschaft, dass die Stärkeren die Spielregeln bestimmen. Es kommt darauf an, sich durch-
zusetzen, um jeden Preis. ...
Kinder aber sind wahre Meister des Mitgefühls. Sie ahnen, wie es dem anderen geht, sie lassen Schmerz zu ... Sie haben ein sehr feines Gespür
für Schwingungen. Sie beobachten genau. Sie bekommen mit, was den anderen bewegt, wie er sich fühlt, was los ist. ... So spüren sie mehr,
als ihre Eltern für möglich halten; ... ." (S.163 ff.)
"... Mitgefühl ist uns in die Wiege gelegt wie die Fähigkeit zum Atmen.
Wir Menschen haben es so weit gebracht, weil wir uns kümmerten. Und nicht den Wettbewerb verschärften. In einer Gesellschaft, in der sich
immer mehr Menschen allein und ausgeschlossen fühlen, können wir es uns nicht leisten, unseren Kindern von klein an die Fähigkeit zur
Empathie auszutreiben. Wir Menschen brauchen einander. ..." (S. 170)
"... Und nicht nur die Kinder. Immer mehr Menschen leiden unter der genormten Welt von heute. .." (S. 185)
"... Wir wollten davon erzählen, wer unsere Kinder sind und was aus ihnen werden könnte.
Was aus ihnen endlich werden könnte, wenn sie nicht länger in den Betonmauern unserer Bewertungen und Zuschreibungen eingegossen würden.
Wenn wir sie nicht mehr zu Opfern unseres überkommenen, aus dem vorigen Jahrhundert stammenden und durch nichts zu begründenden und zu
rechtfertigenden Begabungskonzeptes machten. Eines Begabungskonzeptes, das dazu geführt hat, dass unsere Schulen wie Erbsensortieranlagen
funktionieren. Zu viele fallen dort durch die Maschen.
Es wird Zeit für uns Erwachsene, genauer hinzuschauen und uns zu fragen, wie lange wir noch zulassen wollen, dass unsere Kinder in eine Welt
hineinwachsen, in der sie wie Maschinen, Spalierobst oder Computer behandelt werden. In der sie so zusammengebaut, zurechtgestutzt und programmiert
werden, wie es Eltern, Lehrern und allen anderen gefällt, die ihren Nutzen davon haben. ..." (S. 186)
Maren Rehder, 01.05.2013
Meine pädagogische Maxime hat zwar auch etwas mit Intuition oder mit Vermutung zu tun - wenn diese Vermutung oder auch These jedoch empirisch
widerlegt ist, halte ich i. d. R. nicht mehr länger daran fest.
Also, eine Gedankenkette wie "der zieht sich häufig Schokoriegel am Automaten - vermutlich leben seine Eltern in Scheidung - wegen der Gewichtszunahme
und der undisziplinierten Ernährung stelle ich "den" zu Wettkämpfen gar nicht erst auf, weil er die Zeiten eh nie erschwimmen wird", hat bei mir
wenig Chancen. Schon gar nicht, wenn die zeitlich messbaren Leistungen das komplette Gegenteil meiner "Vorurteile" belegen.
Selbst wenn ein "Fünkchen Wahrheit" an dem Vermuteten wäre, ist der Versuch einer konstruktiven Unterstützung eher sinnvoll als eine Ab-
wertung.
Dem wissenschaftlichen Studium, insbesondere im Fach Kunstgeschichte, verdanke ich, dass die Studierenden zu eigenem und kritischem Denken angehalten
wurden. Vorgefasste Bildinterpretationen der Sekundärliteratur sollten nicht ohne eigene Prüfung übernommen werden, es sollte "selbst
geschaut" werden, ob die Beurteilungen von Bildern oder anderen Kunstwerken aus der eigenen Sicht stimmig sind. Falls nein, sollte versucht werden,
logisch und intersubjektiv nachvollziehbar eine eigene Interpretation des Gesehenen und Erkannten mit nüchternen Formulierungen "dagegen" zu setzen.
Der Versuch der vorurteilsfreien Forschung ist ein Beitrag zu einer erkenntnistheoretischen "Ethik", da Vorurteile einen großen Schaden anrichten
und anrichteten.
So wird sicherlich auch nicht nur EIN "pädagogischer Weg" Menschen zu Höchstleistungen motivieren, sondern es gibt mehrere Wege.
Ein Klischee ist noch, dass Frauen, obwohl sie z. B. empirisch nachgewiesen, bereits am Wettkampfbereich bzw. in Kooperation damit, tätig
waren, "nur" für die Anfänger/innen-Schwimmausbildung "geeignet" seien, weil bestimmte einfältige Denkweisen über Frauen in anderen
Gehirnen dieses so unterstellen. Die Frau als Dienstbotin, die Frau als Mutter, die Frau als Untergebene - das sind Klischees, die häufig dazu da sind,
um sich selbst aufzuwerten, zumal dann, wenn man offenbar kein "richtiges Verhältnis" zu Frauen entwickeln konnte, das diesen angemessen ist.
Solche Zuschreibungen und falsche Fremdbeurteilungen von Menschen, die eigentlich selbst nicht die nötige Sachkompetenz besitzen, aber aus
irgendwelchen Gründen leitende Funktionen ausüben dürfen, blockieren so manchen Lebensweg und machen anderen das Leben schwerer.
Von daher ist es ein Beitrag zur Ethik, Tatsachen zu bedenken und in Beurteilungen miteinzubeziehen. Im Grunde sollte es überflüssig sein, so etwss
hier zu erwähnen.
Pädagogik hat auch etwas mit "Kunst" oder einem richtigen "Gespür" zu tun - das ist der weniger leicht lernbare Anteil an diesem Fach. Eigentlich
beinhaltet die korrekte Ausübung fast jeglichen Sachgebiets künstlerische Komponenten, die zu dem leichter erwerbbaren Wissen "dazu" kommen.
Diesem künstlerischen Anteil an jedem Sachgebiet wird oftmals zu wenig Raum gegeben - eine Sache soll wie ein Fahrplan funktionieren, was eben nicht
immer zum Ziel führt. Außerdem sollten sich Trainer/innen bewusst sein, dass die eigenen Erfahrungen nicht unbedingt auf andere genauso zutreffen.
Ein "Phlegmatiker", der Druck "braucht", ist nicht vergleichbar mit einer antriebsstarken Person, die durch das Vorurteil, auch sie brauche "Druck", nur
blockiert wird. Menschen sind eben unterschiedlich und ursprünglich Originale. Darauf wollte der Hirnforscher Gerald Hüther mit seinem o. g.
Buch besonders aufmerksam machen. Hat Pädagogik nun die Aufgabe, solche Unterschiede und Eigenarten der Menschen zu vereinheitlichen?
Maren Rehder, 06.05.2013
Und natürlich geht es vielen um MACHT - um die Selbstaufwertung eines als viel zu gering empfundenen Egos, um das Erzeugen von Abhängigkeiten -
allzu häufig auf Kosten anderer! Ein beliebter psychologischer "Trick" kann z. B. die physische Erhöhung sein - ein(e) Trainer/in, der/die (subjektiv)
um seine/ihre Macht fürchtet, kann z. B. die Mittrainer/innen von einem erhabenen Standpunkt am Beckenrand aus beobachten oder dirigieren, während sich die
Kolleg(inn)en "eine Etage tiefer" im Nichtschwimmerbecken befinden. Mit in die Hüften gestemmten Händen steht ein(e) Trainer/in am Beckenrand und schaut
auf die anderen herab, macht sich körperlich größer - bewusst oder unbewusst - gezielt als taktisches Mittel.
Auch das Vorenthalten von Informationen bzw. das einseitige Verzichten auf Transparenz kann ein Versuch sein, um Wissensvorteile und somit Macht zu sichern.
Jemand will sich nicht "in die Karten schauen" lassen, fordert gleichzeitig aber alle Informationen von den Mittrainer(inne)n, wobei die anderen, wenn sie sich
in einer abhängigen Lage befinden oder auch nur freundlich bzw. "wohl erzogen" sind, nicht ausscheren (dürfen). Das ist ein Ausnutzen von Macht - ein Machtmiss-
brauch, wenn sich die anderen kaum dagegen wehren können bzw. wollen aufgrund ihrer weniger mächtigen Position oder ihres fairen Verhaltenskodex und aufgrund dessen,
dass Machtmissbrauch als solcher kein Straftatbestand ist, wohl aber bei vielen Straftaten de facto eine Rolle spielt.
Auch subtiler oder indirekt kann Macht demonstriert werden beispielsweise durch leises Sprechen vor Gruppen - die Wirkung und der Aufmerksamkeitsfaktor sind enorm!
Macht im positiven Sinne bedeutet Schutz, Gestaltung, Fürsorge, Sachkompetenz oder sogar Expert(inn)enwissen, Könner/innenschaft, Teamgeist, Führungs-
fähigkeiten, Selbst- und Fremdkontrolle, Gerechtigkeitssinn, Teilenkönnen, Respekt, Integrität, Wohlwollen, Förderung, Kommunikationsfähigkeit,
Transparenz, Reglement, Fairness, Konfliktfähigkeit, Selbstbewusstsein, positiver Selbstwert, realistische (reife) Selbsteinschätzung, Kritikfähigkeit,
Mut zu Fehlern, "Werte", Authentizität, "Menschenkenntnis", Empathie sowie allgemein Mut, Durchsetzungsvermögen, Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit,
Berechenbarkeit, Verantwortungsgefühl, Verantwortungsbewusstsein und Verantwortungsübernahme u. v. a. m.
Jemand, der mit Macht umgeht, sollte auch ohne sie auskommen können und nicht von ihr (psychologisch) abhängig sein, ausgenommen sind m. E. n. soziale Notlagen,
wenn diese bei Machtverlust als Folge auftreten - eine soziale Abhängigkeit von Macht ist zumindest für mich verstehbar.
Alle Wesen besitzen "von Natur aus" jedoch eine gewisse Macht - niemand ist vollkommen ohnmächtig oder machtlos. Allein wenn ich irgendwo stehe oder sitze, nehme ich
Platz ein und habe dadurch schon eine Geltung.
Große Angst und Macht passen eigentlich nicht zueinander, kommen aber tatsächlich in dieser Kombination sehr oft vor!
Wahrscheinlich ist eine Machtposition nur von ganz wenigen Personen tatsächlich vorbildlich ausfüllbar, da die Anforderungen an die Eignung sehr hoch sind.
Maren Rehder, 21.05.2013
Es gibt immer noch etwas Neues zu entdecken. Als eine ÜL einmal sagte, sie wäre für das Erlernen des Kraul mit Anfang 30 zu alt, musste ich schmunzeln.
Durch die konstruktive Kritik eines Mitschwimmenden verbesserte ich meine Kraul-Technik, nicht nur feilte ich seit Weihnachten 2012 an der Rückkehr zu meinem alten
Kraul-Stil - weg von stilisierten und vorgegebenen Kraulschwimmarten - sondern ich verbesserte auch meine Wasserlage - das wiederum übernahm ich z. B. Lehrbüchern
- das "Bergab"-Schwimmen - wie es so schön heißt - ein "Schwimmkommilitone" hatte beobachtet, dass ich mich nicht wirklich parallel zur Wasseroberfläche bewegte.
Nun senkte ich den Kopf etwas ab, so dass sich die Hüften mehr hoben. Mein Blick fiel derweil fast senkrecht auf den Schwimmbadboden, allerdings noch leicht nach vorne gerichtet.
Tatsächlich schwamm ich plötzlich 50 m in ca. 45 Sek. ohne Startsprung und ohne maximale Anstrengung - nur ein Beispiel dafür, dass sich Technik-Training lohnt.
Das war mir vorher noch NIE gelungen - jetzt kann ich ganz gut mit den anderen Teilnehmenden meiner informellen Schwimmgruppe mithalten, die überwiegend aus Herren besteht.
Zuvor war ich doch eher eine Art "Schlusslicht", das zwar zügig schwamm, aber nicht wirklich zu den "Überfliegenden" zählte.
Die gemischte Zusammensetzung solcher qualifizierten Schwimmgruppen, die informell sind und durchaus auch Wettkampfschwimmende beinhalten, finde ich immer wieder spannend.
Im Gegensatz zu vielen Dingen des Lebens verbindet sich hier oftmals Geist und Seele - die körperliche Ebene ist ohnehin vorhanden.
Ich meine damit, dass hier Menschen in ihrer Individualität so sind, wie sie sind. Sie reagieren auch mal emotional, sind ehrlich, halten i. d. R. nicht an einer Fassade
fest, und ohne geschultes Management funktioniert so ein Mikrokosmos irgendwie so, dass die meisten Menschen zufrieden nach Hause gehen, selbst dann, wenn die Bahn mal super voll
war.
Maren Rehder, 23.05.2013
Ein ernstes Thema "Sexueller Missbrauch im Sportverein" - allgemeiner gefasst, halte ich Machtmissbrauch für genauso relevant, der nicht nur im Sport vorkommen kann und etwas
mit sexuellem Missbrauch zu tun hat. Z. B. kann jemand etwas leiten ohne die nötige Sachkompetenz nachgewiesen zu haben und aber die Verantwortung (und damit die Haftung) für
sein Handeln an andere, sachkompetentere Funktionsträger/innen delegieren. Diese niedrigeren Ränge haben wenig Gestaltungsspielraum, sind kaum mit Rechten ausge-
stattet bei gleichzeitig hoher Verantwortung und eben nur geringem Einfluss.
Dieses Führungsprinzip wird in der Betriebswirtschaft (auch bei der Bundeswehr) angewandt und findet seine namentliche Bezeichnung im sog. "Harzburger Modell",
das wegen seiner Verstrickung mit dem NS-System durch eines seiner Begründer, Prof. Reinhard Höhn, heftig in die Kritik geriet.
In jedem Fall ist feststellbar, dass ein schlechtes Teamplay "von oben herab" in der Splittung von Führung und Verantwortung grundsätzlich angelegt ist.
Auf quasi erpresserische Art und Weise tragen die in der Hierarchie niedrigeren Ränge aufgrund ihrer Abhängigkeit die größte Verantwortung,
wenn ihnen keine Alternativen zur Verfügung stehen. Um ein Verhältnis "auf Augenhöhe" handelt es sich jedenfalls nicht!
Es geht allein um das Delegieren oder Abwälzen der juristischen Verantwortung von "oben nach unten", wobei die unteren Ränge zu bloßen Befehlsempfangenden
degradiert werden können, wenn die Schulbildung und das Wissen um Immanuel Kants Leitgedanken "sapere aude" oder "Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!"
bei diesen so gut wie "versagten".
Ohne Wertschätzung ihrer Qualifikationen im eigentlichen Sinne werden die Rangniedrigeren nur von den oberen Rängen "benutzt", ohne dass diese selbst
qualifiziert sein müssen.
Diese Rechtsbeziehung wird zumeist sogar per Vertrag so geregelt, so dass die unterlegene Partei auch außerhalb des Militärs zu unkritischem Verhalten
im Grunde gezwungen wird. In militärischen Organisationen sind solche Strukturen m. E. n. durch ihre Wesensgemäßheit vertretbar, sie kennzeichnen das
Wesen des Militärs - ob solche Strukturen jedoch beliebig auf andere gesellschaftliche Bereiche übertragbar sind, bezweifle ich allerdings, zumal diese
Frage der Übertragbarkeit auch eine ethische ist.
So einseitig kann der Begriff "Teamfähigkeit" offenbar ausgelegt werden. Es geht allein um das Befolgen von Befehlen - dabei müssen mächtigere Parteien
ganz und gar nicht "teamfähig" sein, da sie diesen Begriff nicht neutral sachlich definieren, sondern nur in Bezug auf das Ausrichten des Verhaltens einer unterge-
benen Person innerhalb der gesetzten Hierarchie. Der Begriff der Teamfähigkeit wird hier eigentlich missbräuchlich verwendet, weil er vielmehr Gehorsam und Anpassung meint!
Karl Popper sah daher den Wert der Demokratie vor allem im Einhalten demokratischer Regeln und Strukturen und nicht in Beziehungswerken, die z. B. gegen solche demokratischen
Prinzipien verstoßen können. Hierin bestand außerdem eine von Poppers Haupterkenntnissen zum Schutz vor Diktaturen. Nicht Beziehungen, sondern demokratische Prinzipien
und Gesetze sowie Regeln sollen in einem Staatswesen mit einer offenen Gesellschaft den Ton angeben - als Schutz vor menschlicher Willkür.
Im Sportverein wünschen sich wohl viele ein tatsächlich demokratisches Miteinander - es kann aber der Eindruck entstehen, dass solche "Enklaven", dadurch dass
sie wie Nischen fungieren, "besonders" machtambitionierte Menschen, die sich manchmal in anderen Bereichen als benachteiligt empfinden, anziehen.
Maren Rehder, 28.05.2013
Heute Abend erfuhr ich, dass eine Schwimmabteilung ohne einen einzigen C-Trainer oder eine Trainerin rein rechtlich gesehen gar nicht den Betrieb aufrecht erhalten darf.
Wir leben in einem freien Land: Wo kein Kläger, da kein Richter!
Dass diese spezielle Person mit Lizenz dann die Hauptverantwortung für die gesamte Schwimmabteilung trägt, wurde mir auch vorher nie transparent mitgeteilt, jedenfalls
nicht von jenen, von welchen ich so eine Mitteilung aufgrund ihrer Zuständigkeit erwartet hätte.
Ich dachte immer, dass ein Inhaber oder eine Inhaberin des Rettungsschwimmabzeichens Silber die Hauptverantwortung für die Schwimmabteilung trägt, wenn keine weiteren
Personen mit dieser Qualifikation vorhanden sind, aber offenbar steht der Lizenz-Inhaber oder die Inhaberin der Trainer/innen-Lizenz noch darüber.
So wäre es fair von den anderen, nicht nur ihrer Klientel gegenüber, wenn sie ebenfalls eine Lizenz erwerben würden.
Oder aber: Eine Art Aufsicht wie die Gewerbeaufsicht würde in Aktion treten und dann eben solche Schwimmabteilungen, selbst wenn sie noch einen gewissen Marktwert nachweisen,
aber regelwidrig existieren, eben leider vom Markt entfernen.
Das war der ursprüngliche Sinn der freien Marktwirtschaft - freier Wettbewerb, aber nach (sozialverträglichen, gerechtigkeitsfördernden) Regeln!
Fragen tue ich mich dennoch bisweilen: Finden Mehrheitsentscheide immer auf dem Boden der Demokratie statt, sind diese auch gültig, wenn dadurch Rechtswidrigkeiten
geduldet werden - Immanuel Kant forderte u. a., dass auch Mittel Regeln unterliegen, und somit nicht Ziele regelwidrig erreicht werden dürfen.
Da könnte man ja gleich sagen, die einen dopen halt, die anderen eben nicht. Man ist selbst verantwortlich, für welche Seite man sich entscheidet - beides existiert
als Marktwert sozusagen gleich nebeneinander. Auch das regelwidrige Dopen ist genauso erlaubt wie das Nichtdopen.
Wo bleibt die Kontrolle? Wieso werden Regeln aufgestellt, wenn sie von einigen mit Hinweis auf Mehrheitsentscheide gebrochen werden? Wieso werden die Kontrolleure kaum
kontrolliert?
Ist man also selbst Schuld, wenn man nicht mit gezinkten Karten spielt?
Maren Rehder, 31.05.2013
Das "Harzburger Modell", welches offenbar i. d. R. in abgewandelter Form eingesetzt wird und heute eine Spaltung von Handlungs- und Führungsverantwortung vorsieht,
entlässt somit die Führungsebene nicht aus der Verantwortung!
Vielleicht wird der Missbrauch des "Harzburger Modells" auch von einigen Betriebswirtschaftler/innen beklagt - eine hohe Missbrauchsanfälligkeit eines solchen Modells
muss jedoch angenommen werden, und diese genügt m. M. n. als Indikator für das Ablehnen einer solchen Führungskonzeption.
So wird auf der Site "http://www.leadion.de/artikel.php?artikel=0520" auf folgende möglichen Nachteile hingewiesen (die unterstellten Vorteile werden ebenso erwähnt):
Möglichkeit der unfairen Delegation (delegieren unbeliebter und risikobehafteter Aufgaben)
Missbrauch als Machtinstrument durch subjektive Manipulation des Delegierenden
Fehleinschätzung der zu delegierenden Aufgaben hinsichtlich der Mitarbeiterqualifikation
in der Praxis ggf. schwer umsetzbar durch Machtgedanken der Führungsebene
Wirklichkeit komplexer Systeme konnte nicht erfasst werden
hoher bürokratischer Aufwand, bspw. durch Handbuch, Stellenbeschreibung
Als ganzheitlich denkender Mensch sehe ich das Trennen von Führen, Handeln, Sachkompetenz, Leitungskompetenz und Verantwortung als fingiert an.
Die Trennungen erscheinen mir wie Kunstgriffe. Verantwortung hängt von Vereinbarung, Vertrag und Kommunikation ab und nicht mehr von ihrem Bezug
zur Sache bzw. zu einem Zusammenhang und verliert damit Wesensgemäßes! Die Zuschreibung von Verantwortung wird an Personen und Positionen gebunden,
nicht mehr an ihren sachlichen Inhalt. Es besteht die konstruierte Möglichkeit, sich von Verantwortung frei zu sprechen. Ich sage, Du bist verantwortlich
für das Gelingen meiner Sache, damit ich nicht verantwortlich sein muss.
Zusammenhanglose Einzelteile machen noch kein Ganzes aus bzw. lassen ein Ganzes sogar vermissen und existieren additiv nebeneinander her.
Maren Rehder, 03.06.2013
Die idealistische Philosophie (teleologisches Geschichtsbild; der Geist prägt die Materie) tendiert zum Ausblenden des tatsächlich Machbaren,
zum Unterschätzen von Risiken.
Alles Leben existiert in Wechselbeziehungen, auch mit der unbelebten Natur - kein Element kann autonom über die anderen entscheiden, wie es jedoch
der Idealismus quasi dem Menschen zuschreibt, solche Entscheidungsgewalt zu besitzen.
Die Autonomie des Menschen ist - realistisch betrachtet - brüchig und unterliegt Abhängigkeiten.
Das Mögliche hat Grenzen. Positives Denken ist kein Allheilmittel und vor allem sollte es nicht die Wirkung eines Narkotikums haben.
Leistungen sind auf Machbares begrenzt und optimierbar - das Feststellen einer Grenze ist eine eher nüchterne Tatsache, keine Wertung.
Maren Rehder, 04.06.2013
Autoritärer Drill führt sicherlich zu Ergebnissen - ein Trugschluss ist jedoch, dass nur über "Angst und Strafe" Erfolge und Ergebnisse
erzielt werden - auch werden Pädagogik, Medizin und Psychologie zu extrinsisch motivierten Leistungen ein differenziertes Bild zeichnen, ganz zu
schweigen von ethischen Einwänden.
Burnout, Depression, Sucht, Verhindern des Aufbauens einer eigenständigen, demokratieförderlichen Identität und auch Aggression könnten
bei aller Ergebniserfüllung Begleit- bzw. Folgeerscheinungen von "zu viel" Autorität und Fremdbestimmung sein.
Darüber hinaus gelten unflexible Anweisungen als Kreativitätskiller und können sogar Sachfehler hervorrufen, weil es meistens mehrere richtige
Wege gibt und zudem Sachverhalte komplex, mehrdimensional sind - in jedem Fall blockieren starre Vorgaben alternative, kreative und individuelle Lösungen.
Anders herum begünstigt ein Laissez-faire ebenso wenig die Erziehung des Menschen - Anpassungsschwierigkeiten und "unsoziales" Verhalten treten nicht
selten im Zuge des Fehlens von verbindlichen Vorgaben auf. Der Mensch sucht vergeblich nach Halt und Strukturen.
Einen maßvollen Mittelweg zu finden, ist die schwierige Aufgabe des Pädagogen bzw. der Pädagogin.
Militär und Sport gehören nur da zusammen, wo ein wesensgemäßer Bezug besteht, beim Kampfsport, bei militärisch orientierten
Wettkämpfen etc. Alle anderen Sportarten müssten ihre jeweils eigene Pädagogik entwickeln, die im Grunde aus dem "Wesen" dieser Sportart
hervorgeht.
Ein möglicherweise erkenntniserweiternder Zeitungsbericht zu den "Negativen Spätfolgen autoritärer Erziehung" ist beispielsweise hier
in einem Beitrag aus der "Neuen Zürcher Zeitung" zu lesen. Das Bildungssystem der Schweiz basiert freilich auf einer anderen historischen
Vergangenheit als das deutsche. Z. B. stammten Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) und Jean Piaget (1896-1980) aus der Schweiz. Hans A. Pestalozzi (1929-2004)
lebte als Konsum- und Gesellschaftskritiker und Pazifist im Toggenburg, einer Schweizer Tallandschaft, nachdem er den Ausstieg vom Management gewagt hatte
bzw. entlassen worden war.
PS: Andere Themen - Wassergewöhnung, Wasserbewältigung, Wassersicherheit, Allgemeines - eine Zusammenstellung.
Maren Rehder, 08.06.2013
Die Facebook-Seiten von Evelina Langmaack "Swimming Inspiration" finde ich immer wieder erfrischend, faszinierend, aus dem Leben gegriffen und "klug"!
Evelina schreibt, dass sie aus einer Familie von "Schwimmpädagog(inn)en" stamme - ihre Vermittlungsweise ist von einer liebevollen Zuwendung
zum Menschen, von einer Wertschätzung gekennzeichnet.
Bewegung im Wasser ist mehr als "nur" Schwimmen in vier Stilen - sie hat etwas mit "Kunst" (Ästhetik) zu tun, mit Eleganz, mit einem Dialog zwischen Wasser und Mensch -
manchmal auch mit Musik, mit Rhythmus und natürlich mit Naturwissenschaft u. v. a. m.
Diese Liebe zum Wasser ist das wichtigste, was Menschen "vermittelt" werden und ihnen NIEMALS genommen werden sollte!
Alles andere ergibt sich dann wie von selbst.
Interesse, Neugier, Lust an der Bewegung, Bereitschaft zu Leistungen und zu Entbehrungen, Disziplin und Freude, Teamarbeit, Engagement etc.
Maren Rehder, 15.06.2013
SCHÖNE FERIEN!

|
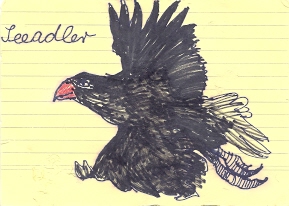
|
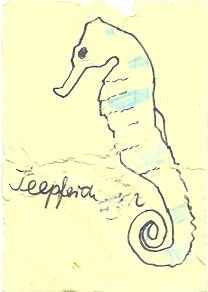
|

|
Maren Rehder, 21.06.2013
PS: Meine "Praxis" ist in den Ferien (leider) geschlossen. Ich hoffe, auf Ihr / Euer Verständnis!:-) DANKE!
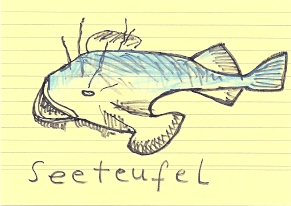
|
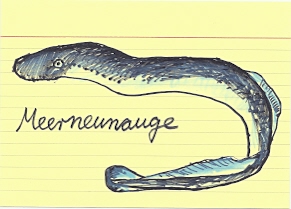
|
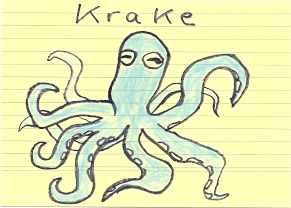
|
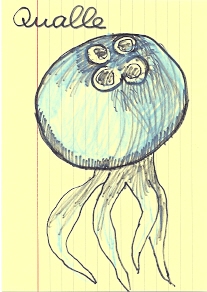
|
Allzu häufig scheint "von anderen" ignoriert zu werden, dass Sport und Bewegung unterschiedliche Motivationen oder individuelle Ziele zu Grunde liegen!
Diese können mit genormten WK-Vorstellungen korrespondieren - Erfolg kann aber vom Individuum her auch ganz andere Deutungen erfahren.
Die Bezeichnung "Freistil" oder "Freestyle" geht auf diese individuelle Freiheit ein - jedoch steht als allgemeines Ziel das Erreichen der besten Schwimmzeit
darüber. Meistens wird daher das Kraulen als Technik für Freistil-Strecken gewählt, da es generell als schnellste Technik im Wasser zählt.
Wie das Kraulen jedoch technisch korrekt ausgeführt wird, unterliegt wiederum individuellen Anwendungen. Es gibt nur ein grobes Schema, das allen Kraul-
stilausprägungen gemein ist. Ein Hauptunterschied liegt u. a. in der zu bewältigenden Streckenlänge. Die lange Strecke wird im Kraulstil anders
bewältigt als die Kurzstrecke bzw. der Sprint. Auch spielen Körperbau und andere biologische Komponenten eine nicht unwesentliche Rolle.
Im Vergleich zur Kurzstrecke ist auf der Langstrecke die Zugfrequenz durchschnittlich geringer - weniger Kraft, mehr Ausdauer ist erforderlich - die Kurzstrecke
kann auch bei weniger Ausdauervermögen und mehr Krafteinsatz schnell geschwommen werden. Demzufolge sind jeweils andere körperliche Voraussetzungen
von Vorteil, wenngleich eine solide Grundlagenausdauer auch für den Sprintbereich förderlich ist.
Gesundheitliche Aspekte können die Wahl der Mittel bzw. des Stils, der Technik weiterhin beeinflussen, zumal dann, wenn außerhalb genormter Bereiche
trainiert wird. Entscheidend ist lediglich die erkennbare Effizienz im Hinblick auf Körperbau, Wasserwiderstand, Auftriebskraft und Technik. Die Eigenschaften
des Wassers sollten positiv genutzt werden - immer wieder sehe ich Schwimmer/innen, die mit dem Wasser wie mit einem Feind kämpfen, zu viel Kraft einsetzen und
die Gleitoptionen durch das Medium Wasser nicht optimal nutzen. Manchmal ist weniger Kraft erforderlich, um sich elegant und schnell durch das Wasser zu bewegen.
Die individuelle Tagesform ist sicherlich mitentscheidend (http://www.youtube.com/watch?v=TAZBkOUEhDA:-).
Maren Rehder, 18.07.2013
Zwischendurch einmal die "Sommer-Nachrichten": http://www.youtube.com/watch?v=EeU8ZEkyirY.
Maren Rehder, 25.07.2013
Sommerfeste finde ich ignorant, einfältig und borniert, die Vegetarier bei ihren Planungen von vornherein weitgehend ausschließen!
Fleisch wird zur dominierenden Grundbedingung für die Teilnahme an Grillpartys erhoben.
Haben die Menschen keine Phantasie, haben sie noch nichts von Tiermast und Massentierhaltung und den Qualen der Schlachttiere gehört?!
Sind Vegetarier kein Teil einer "ordentlichen, deutschen" (Grill-) Gesellschaft?
Was ist daran so schwierig, einen schmackhaften Salat zu bereiten und ein gutes Brot mitzubringen (Fladenbrote können leicht selbst hergestellt und mit
etlichen Leckereien beim Backen wie mit Oliven oder Nüssen versehen werden)? Leckere Kuchen, Torten oder Quarkspeisen sowie Obst-, Gemüse- oder
Käsespieße fallen mir auf Anhieb ein.
Zu einer Sportlerparty brachte ich z. B. einmal in Zitronensaft getränkte Karottenstifte, selbst hergestellten Kräuterquark, Cracker, selbst
gebackene Brownies, dazu Schlagsahne u. a. mit - alles eingepackt in alte, große Joghurtbecher aus Plastik, die ich unbesehen auf dem Fest
lassen konnte, selbst wenn ich nicht mehr anwesend war.
Ich finde Sommerfeste, die Vegetarier derart unverfroren ignorieren, total kalt!
Es reizt mich nicht "die Bohne", an so etwas gerne teilzunehmen!
Maren Rehder, 27.07.2013
Wettkampfsport - Breitensport:
Der Weg des Wettkampfsports ist die SELEKTION - der Breitensport hingegen hat die INTEGRATION zu seiner Maxime erhoben.
Die Anforderungen an die Trainer/innen sind dementsprechend unterschiedlich - während der Leistungstrainer / die Leistungstrainerin in erster Linie
fachorientiert oder streng planorientiert ohne Orientierung am "schwächsten" Kunden bzw. der "schwächsten" Kundin vorgeht, ist der Trainer oder die
Trainer/in des Breitensports dazu angehalten, auch unter Einsatz pädagogischen Geschicks möglichst viele Kund(inn)en zu halten. Der Kunde / die
Kundin mit seinem / ihrem individuellen Wunsch ist König oder Königin.
Im Leistungssport sind oftmals allgemeine Vorgaben zu individuellen Wünschen geworden - so kann der Eindruck des Militärischen entstehen.
Die pädagogischen Anforderungen an das Trainingspersonal sind absichtlich niedriger, weil die allgemeinen Vorgaben, die bekannt sind, die Teilnehmenden
bei Nichtfunktionieren selektieren.
Dahinter steckt selbstverständlich eine These oder ein Vorurteil, dass nur über Selektion "Leistung" erzielt wird, nicht über Integration.
Die Leistung wird allein durch eine an internationalen Standards definierte "Zeit" (Leistung pro Zeit oder Meter pro Sekunde etc.) festgelegt.
Technik oder gar Ästhetik bleiben allenfalls sekundäre Faktoren, gesundheitliche Aspekte ebenfalls - auch individuelle Lernmuster bleiben
weitgehend unberücksichtigt. Alle, das "ordentliche" Trainingsschema störenden Faktoren werden ausgeschlossen - auch Menschen mit besonderen
Fähigkeiten oder besonderen Verhaltensdispositionen, die sich nicht mit den allgemeinen Vorgaben vereinbaren lassen. Im Einzelfall bleibt jedoch oftmals
fraglich, ob diese Unvereinbarkeit von Trainer(inne)n richtig erkannt wurde, d. h. das Anwenden von Ausschlusskriterien hat hin und wieder thetischen bzw.
unterstellenden Charakter - es setzt ein enormes sachliches Urteilsvermögen bei Trainer(inne)n voraus.
I. d. R. können Menschen entscheiden, ob sie so einem Trainingsablauf zustimmen oder nicht.
Hin und wieder erinnert mich dieses Schema jedoch an das Züchten in der Massentierhaltung.
Jedenfalls ist es ein Trugschluss, dass nur über Selektion, Angst und Strafe Leistungen erzeugt werden. In vielfältig gestalteten Breitensport-
gruppen entwickeln etliche Teilnehmende ihre Talente, die sie normalerweise im WK-Sport nicht entwickeln würden. Individuelle Lernwege werden im
Breitensport pädagogisch sinnvoll aufgenommen, und es wird i. d. R. nicht davon ausgegangen, dass Menschen über Angst "motiviert" werden.
Ein positives, wertschätzendes Grundverständnis vom Menschen, das immer noch nachträglich bezgl. des "Einzelfalls" korrigiert werden kann,
bildet die Basis für das Training im Breitensport, das pädagogisch anspruchsvoll für individuelle Wege offen ist.
Denn, fast nichts ist einfacher, als die "Quälgeister" einfach auszuschließen, weil sie den normalen Ablauf stören, oder?
Dennoch sind gerade im Breitensport auch Regeln sehr wichtig, da die Heterogenität bisweilen "ausufern" kann. Letztlich darf ein Trainingsablauf im
Breitensport durch individuelle Besonderheiten auch nicht so beeinträchtigt werden, dass die gesamte Gruppe darunter leidet.
M. E. n. sind in solchen Situationen bei Kindern vor allem die Eltern und auch das Abteilungsmanagement gefragt - Ziele sollten auch im Breitensport vorhanden
und mit den Trainer(inne)n abgestimmt sein. Es gibt Gruppen, die als vorher festgelegtes Ziel vor allem die INKLUSION mit entsprechend gebildetem Trainer/innen-
personal, z. B. in Gesundheitsprävention und Ausbildung in Erste Hilfe auf ihre Fahnen geschrieben haben.
In anderen Gruppen geht es vorrangig um das Reduzieren der Nichtschwimmer/innen bei vorausgesetztem durchschnittlichen Folgsamkeitsvermögen von Kindern.
Technische Feinheiten spielen bei so einer Zielsetzung eine Nebenrolle.
Andere Breitensportgruppen kooperieren wiederum eng mit dem Wettkampfbereich, dienen der Kompensation bei vorübergehender Unterbrechung des Leistungstrainings,
bilden Schwimmer/innen aus, die eher spielerisch an den Wettkampf heran geführt werden möchten, sozusagen als "Vorschule" für den Wettkampf.
Mannigfaltige Ziele gibt es sodann in Erwachsenengruppen - von der aussteigenden Leistungsschwimmerin bis zum Schwimmanfänger, der sich im Leben das Ziel gesetzt
hat, die Grenze der Angst vor dem Wasser noch einmal zu überwinden und im Seniorenalter endlich das Schwimmen erlernen möchte usw.
Der Breitensport ist offen für viele Ziele und ebenso darauf angelegt, mit dem WK-Bereich zu kooperieren, da es letztendlich auch keine einheitliche Leistungsdefinition
gibt. Allenfalls gibt es allgemeine und individuelle Leistungsdefinitionen.
Die Selbstbestimmung der Teilnehmenden in einem Trainingsbetrieb ist vordergründig z. B. über den Dialog zu beachten - sowohl bei den Trainer(inne)n
als auch bei den Trainierenden. Empirische Tatsachen sollten Thesen, die sich nicht erwiesen haben, verändern können. Jedenfalls hat sich Karl R. Popper so
in etwa "Demokratie" und auch Erkenntnistheorie "vorgestellt".
Maren Rehder, 30.07.2013
PS: Sir Karl Raimund Popper wäre am 28.07.2013 111 Jahre alt geworden - wenngleich ich sein Werk "Die offene Gesellschaft und ihre Feinde" als am bedeutendsten ansehe,
halte ich die Zusammenstellung von 12 Thesen zum Lernen von Mitmenschen, wie sie Professor Ulrich Seidenberg auf der Basis von Poppers "Logik der Forschung" vornahm,
für sehr lesenswert - siehe hier http://www.wiwi.uni-siegen.de/wiwi/prod/downloads/12popperthesen.pdf.
http://www.youtube.com/watch?v=2bPvk0paWcg&list=PLEEE0B0AD29CE7587
http://www.youtube.com/watch?v=a1KIDbO9Gdo
http://www.youtube.com/watch?v=omNLIGgtGHc
Maren Rehder, 31.07.2013
Schade, der Sommer nähert sich seinem Ende, und ich habe aber immerhin noch ein Highlight entdeckt, nämlich ein erfolgreiches, kostengünstiges, unkonventionelles Mittel gegen ...
Dornwarzen!
Zudem ist die Therapie relativ kostengünstig und basiert auf natürlichen Stoffen.
Des Weiteren kann die Anwendung auch bei anderen Diagnosen stattfinden - das Mittel ist vielseitig einsetzbar.
Die Warzen treten innerhalb von ca. 14 Tagen den Rückzug an. Prima!
Im persönlichen Gespräch oder auf Anfrage bin ich gerne bereit, diesen Tipp weiterzugeben.
Maren Rehder, 03.08.2013
Neoliberal bedeutet aus meiner Sicht in erster Linie "zweierlei Maß" - bei Regelverstößen im "oberen Bereich" wird großzügig weggesehen, wobei dieselben
Regelverstöße im "unteren Bereich" sofort geahndet worden wären.
Auch bedeutet Neoliberalismus das willige Konstruieren von Möglichkeiten, jemanden an der Macht zu halten, selbst wenn viele nachgewiesene Sachfehler vorliegen.
So könnte via Abstimmung beispielsweise der Coup gelingen, aus einer "5" in Kopfrechnen eine "1" zu machen, wenn einfach die Mehrheit die "Meinung" vertritt,
die "5" sei eine "1". Wenngleich ich als Grundschülerin so meine Probleme mit der Mengenlehre hatte, ist mir heute einleuchtend, wie wichtig es ist, zwischen "Äpfeln und
Birnen" unterscheiden zu können! So ist mir klar, dass der Schluss unzulässig ist, wenn jemand zu wenig Sachkompetenz hat, dieses mit seiner Methodenkompetenz ausgleichen
zu wollen, zumal mich so eine Person vielleicht zur eigenen Werbung für ihr manipulatives Unternehmen gewinnen wollte. Da mache ich nicht oder allenfalls ungern mit!
Bin ich das Werkzeug eines anderen oder einer anderen?
Besonders einige Beamte bzw. Beamtinnen mögen an dieser Stelle die Stirn runzeln und sich fragen, ob sie jemals etwas anderes getan hätten.
Natürlich sind Sach- und Methodenkompetenz miteinander verwoben - dadurch mag der Rückschluss zulässig sein, wenn das Faktenwissen sehr mangelhaft ist, auch an der Methoden-
kompetenz zur Aneignung von Wissen gearbeitet werden müsste!
Schade, dass der Sommer geht!
In schöner Atmosphäre habe ich intensiv an meinem Kraulstil gefeilt.
Jetzt bin ich wieder fast so schnell wie vor 8 Jahren, na ja, 1 Minute habe ich ungefähr "verloren". Das wird jedoch im Grunde niemanden interessieren, da die Sachkompetenz
nicht entscheidend ist! Siehe oben.
Zu meiner Schulzeit war das noch anders: der Deutschlehrer sagte, wir hätten die "Art und Weise" von Menschen, sofern diese nicht gegen bestimmte Gesetze verstoßen würden,
zu akzeptieren. Ein "Rausschmeißer" konnte vor allem mangelnde Sachkompetenz sein!
Toleranz und Demokratie wurden so definiert - das "So-Sein" gehörte zur individuellen Freiheit der Person.
Problematisch wird es jedoch, wenn inkompetente Menschen aufgrund ihrer vorwiegenden Methodenkompetenz auf Schlüsselpositionen sitzen - sie richten Schaden an, da eine Sache eben auch
Sachkompetenz benötigt!
Zu meiner Schulzeit war klar, wer leider im Vokabeltest versagte, konnte nicht erwarten, dennoch eine super Zensur zu erhalten. Grenzen wurden gesetzt. Andere waren eben besser!
Das ist auch ein Teil von Gerechtigkeit!
Die Frage ist nur, wer diese in einer neoliberalen Zeit einfordert?!
Dann traf ich neulich auf so ein Naturtalent - eine tolle Schwimmerin und schnell!
Nein, ihre Zeiten interessierten sie gar nicht. Sie würde nur aus Lust und Laune schwimmen und weil sie hauptsächlich surfe. Andere seien wirklich schnell, sie nicht.
Chapeau! Also, das nenne ich Selbstbewusstsein! Diese Schwimmerin benötigte keine Selbstbestätigung und keinen Wettkampf, obwohl sie das Zeug (nicht nur dazu) hätte!
Sicherlich vereinte sie beides - Sach- und Methodenkompetenz und Ethik! Andere wollte sie nicht über den Tisch ziehen - wozu auch? Ihre Leistungen genügten für ein
geradliniges Spiel!
Maren Rehder, 31.08.2013
"Schwimmen bei Herz-/Kreislauferkrankungen" ist ein vielschichtiges Thema. Das Herz als eines der wichtigsten Organe, um Leben und Aktivität zu ermöglichen, wird trotz
seiner zentralen Rolle oftmals im Trainingsalltag zu wenig beachtet.
Todesfälle unter Sportler(inne)n gehen nicht selten auf unentdeckte Herzerkrankungen zurück.
Bei Herzinsuffizienz sollte z. B. darauf geachtet werden, dass die Wassertemperatur beim Schwimmen oder der Wassergymnastik nicht zu kalt ist, da Kälte die Gefäße
verengt - die Folge kann eine Überlastung des Herzens sein - Wassertemperaturen bei 29-33 Grad sind optimal (beim Schwimmen in kälterem Wasser kann ein Neoprenanzug helfen)
- eine Pulsuhr sollte zur Kontrolle der Herzfrequenz getragen werden.
Tückisch und häufig unentdeckt können Herzmuskelentzündungen (Myokarditis) daher kommen, die manchmal in der Folge von verschleppten Infekten auftreten. Bei Ignorieren
der ersten Symptome kann eine Überbeanspruchung des Herzmuskels zu heftigeren Symptomen führen, die manchmal denen eines Herzinfarkts oder einer Angina pectoris ähneln.
Bei sofortiger körperlicher Schonung werden diese Symptome ganz allmählich wieder gelindert. Eine sachliche Schilderung mit persönlichem Bericht hat die Trainerin
Monika Sturm-Constantin geschrieben - siehe hier.
Maren Rehder, 29.09.2013
Relativ unerforscht scheinen außerdem die Auswirkungen von "zu viel" Trichloramin und anderen chemischen Verbindungen aus dem Schwimmbad auf die menschliche Gesundheit zu sein.
Einen Kommentar dazu fand ich z. B. auf der Site von "Landeruns Hütte" - siehe hier als PDF: Trichloramin_LanderunsHuette_16092014.pdf.
Maren Rehder, 16.09.2014
US-amerikanische und chinesische Wissenschaftler fanden heraus, dass giftige Substanzen aus einer Reaktion von Harnsäure und Chlorverbindungen entstehen können.
Diese Stoffe, die als Abfallprodukte in chlorierten Bädern anfallen, können Krankheiten verursachen, darunter Krebs - siehe dazu folgenden Beitrag.
Das Umweltbundesamt hat Grenzwerte beispielsweise für die Trichloraminkonzentration in chlorierten Bädern formuliert.
Die Hygiene der Badegäste ist die eine Seite, die Kontrolle der Grenzwerteinhaltung die andere.
Chlorierte Bäder sollten zudem über moderne Filteranlagen verfügen und auch ansonsten bauliche Strukturen aufweisen, die Hygiene vereinfachen und das Zusetzen von Chlor u. a.
minimieren, damit die Bewegung im Wasser auch wirklich gesund ist.
Alternative Wasseraufbereitungsverfahren sollten weiterentwickelt und der Desinfizierung mittels Chlor vorgezogen werden.
Maren Rehder, 18.09.2014
Weitere und nähere Informationen zu der vorangegangenen Darstellung sowie speziell zum Babyschwimmen finden sich in der Beilage GESUND, Nr. 8/2015 des Hamburger Abendblattes vom 24.04.2015.
Maren Rehder, 25.04.2015
Es gibt auch noch andere schöne Sportarten außer Schwimmen: https://www.youtube.com/watch?v=ei9ktUuHh3E oder https://www.youtube.com/watch?v=Aml4-hJxNBs
oder https://www.youtube.com/watch?v=S1hmpaXDHfg:-)
Maren Rehder, 25.06.2015
Aufgrund der derzeit schlechten Bädersituation in Kiel ist es mir aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich, Schwimmunterricht und Schwimmtraining in Bädern, die offenbar
über hohe chemische Einträge* verfügen, weiterhin durchzuführen.
Das Vorhandensein von sog. Aktivkohlefiltern halte ich für einen technischen Standard, der von öffentlichen Bädern eingehalten werden sollte, um gesundheitsschädlichen Folgen
vorzubeugen. Badbesuche in Bädern, die solche technischen Mindestanforderungen nicht erfüllen, muss ich leider weitgehend ablehnen!
Das Einhalten der Grenzwertempfehlungen des Umweltbundesamtes bezgl. der Chemikalienlast in öffentlichen Bade- und Schwimmeinrichtungen sollte unter ständiger Kontrolle stehen.
Eine Reduzierung der Frequenz der Badbesuche in technisch minderwertigen Bädern käme einer Gesundheitsprävention vielleicht noch entgegen.
Des Weiteren leistet selbstverständlich das Hygieneverhalten der Badegäste insgesamt einen Beitrag zur Entstehung bzw. Verminderung toxischer Verbindungen in öffentlichen Schwimmbädern.
Die chemische Reaktion von Harnsäure und Chlor wird wissenschaftlich als äußerst bedenklich bzw. toxisch eingestuft.
Chlor schädigt außerdem die Hautbarriere und irritiert das Immunsystem - es kann eine Dysbalance entstehen, so dass Krankheitserreger ein leichteres Spiel haben.
Eine transparente Informationspolitik halte ich wegen der Relevanz der möglichen Auswirkungen technisch weniger gut gerüsteter Bäder für geboten! Badbetreiber sollten zur Offenlegung
der eingesetzten Chemikalien veranlasst werden! Dieses könnte beispielsweise mittels einer Tafel erfolgen, die öffentlich einsehbar ist und regelmäßig aktualisiert wird.
Nicht zu vergessen: Verbraucherverhalten spiegelt auch Vertrauen bzw. ein (berechtigtes) Misstrauen wider.
Maren Rehder, 15.08.2015
* Die Chemikalienbelastung eines öffentlichen Schwimmbades lässt sich bei unangekündigten, unabhängigen Messungen und vollem Betrieb - nicht in einem stillgelegten Bad - ermitteln.
Ein Schwimmbad ist durch seine Funktion und damit Benutzung durch Menschen gekennzeichnet und nicht durch einen Ruhezustand - ein solcher vermittelt ein verfälschendes Bild, was z. B. Einträge
von gebundenem Chlor oder das Vorkommen von Escherichia coli betrifft. Diese Einträge sind nämlich i. d. R. nutzerabhängig und von Menschen gemacht.
Nur bei Benutzung können Filtersystem und Wasseraufbereitung überprüft und damit Aussagen über die gesamte Funktionsfähigkeit eines Bades getroffen werden.
Bezüglich des Erhaltens der Hautgesundheit im Wasser sind hier ein paar Hinweise in Kiel allgemein zugänglich gemacht worden.
DANKE für das Lesen!
Last but not least: Zu danken habe ich allen Schwimmschüler(inne)n, die an meinen Schwimmstunden teilnahmen! I. d. R. habe ich gerne versucht Schwimmen zu vermitteln und hoffte, dass
beim Umgang mit dem Wasser auch die Freude nicht verloren geht! In besonderer Erinnerung bleibt mir meine Schwimmgruppe des PTSK e. V., die ich dienstagabends von 18.00 bis 19.00 Uhr in der Uni-Schwimmhalle
auf Bahn 5 ab dem DSV-Abzeichen Bronze für Kinder und Jugendliche unterrichtete und die mir zeigte, dass auch in heterogenen Gruppen sehr gute Leistungen gedeihen sowie dass soziales Lernen praktiziert wird.
Aber auch die Anfänger/innengruppe des Gettorfer Turnvereins e. V., die ich donnerstags im Lehrschwimmbecken der CAU anleitete, hat mir zu interessanten pädagogischen Einsichten verholfen.
Die Kieler Universitätsschwimmhalle soll übrigens mit sog. Aktivkohlefiltern zur Wasseraufbereitung ausgestattet sein.
Ebenso bin ich der DLRG dankbar, dass ich dort vor allem mit sicherheitsrelevanten Aspekten des Schwimmens und des Unterrichts konfrontiert wurde und an die Teilnehmenden meiner Schwimmstunden diese
weitergab - dazu zählte z. B. das sog. passive Schwimmen, das Sich-über-Wasser-halten, ohne dass schon ausgefeilte Schwimmtechniken beherrscht werden, die Nutzung des Wasserauftriebs, um Kräfte
zu sparen etc. Natürlich gehörte auch das Rettungsschwimmen dazu, das ich als Trainerin können sollte.
Insgesamt habe ich mich auf alle Schwimmstunden gefreut und mit den vielen Kindern und Jugendlichen gerne zu tun gehabt!
Maren Rehder, 19.09.2015
Zur Aufrechterhaltung einer gesunden Haut- und Schleimhautflora, die widerstandsfähig ist sowie zur Stabilisierung des Immunsystems empfehle ich die regelmäßige Einnahme von Probiotika.
Allerdings ist es wichtig darauf zu achten, welche Bakterienstämme in den gewählten Produkten enthalten sind und ob diese speziell der Gesundheit der jeweiligen Konsumentin/des jeweiligen Konsumenten
zuträglich sind.
Milchsäurebakterien bilden im natürlichen Gleichgewicht unserer Hautbesiedelungen Kontrahenten einiger Mikroorganismen, die uns bei ihrer Expansion krank machen können.
Ein Ungleichgewicht der Besiedelung mit Mikroorganismen auf und in unserem Körper - eine Schieflage des Ökosystems - ist zumeist an der Ursache für eine Erkrankung beteiligt.
Leider musste ich auf diese Erkenntnis bisher selbst kommen, da mir über dieses Basisverständnis keine Schulmedizinerin und auch kein Schulmediziner die Augen öffnete.
Ein funktionierendes Immunsystem ist zumeist der Schlüssel zur Abwehr etlicher Erkrankungen, der nicht nur die Hautbarriere bei der Konfrontation mit aggressiven Stoffen betrifft.
Die Fokussierung eines Körperteils bei der Behandlung von Erkrankungen unter Ausblenden möglicher Entstehungsursachen, Zusammenhänge und Dispositionen führt meistens nur zu kurzsichtigen Erfolgen,
wenn überhaupt.
Beispiel: Die Ursache für eine Akne-Erkrankung mit Antibiotika zu behandeln, fördert erneut das Ungleichgewicht der Bakterienflora im Körper. Die Ursache wird nicht behoben und könnte zum Beispiel
mit falscher Ernährung, einem Mangel an Milchsäurebakterien u. ä. zusammenhängen. Mit solchen Erwägungen wären ganzheitliche Behandlungsansätze gegeben, jedoch mit der einseitigen
und zumeist vorübergehenden Eliminierung von Akne-Ausbreitungen an bestimmten Körperstellen wird nur additiv ein Teil des Körpers erfasst, dessen Zusammenhänge jedoch ausgeblendet werden.
Fazit: Die Erkrankung kommt wieder oder verschiebt sich. Ändern sich zufällig auch andere Entstehungsparameter, mag dies zu einer vollständigen Heilung führen, die auf diese Weise jedoch
bewusst nicht induziert war.
Außerdem rate ich neben anderen Ernährungskomponenten zum täglichen Trinken von Grüntee, insbesondere von Bio-Bancha-Tee, damit der Körper in den Genuss von wertvollen Flavonoiden und Polyphenolen
gelangen kann, welche Widerstandskraft und Schutz von Pflanzen ausmachen. Bitterstoffe, z. B. in Rucola oder Chicoree, gelten als magenfreundlich. Senföle erhöhen ebenfalls die Abwehrkräfte.
Oftmals stecken in besonders robusten Pflanzen wie Rettich, Rote Bete, Zwiebeln und Kohlarten wie Kopfkohl, Rosenkohl und Grünkohl die besten Inhaltsstoffe.
Frische Kräuter, insbesondere Petersilie, nutze ich zum Verfeinern, für Vitaminspenden und neben den zuvor genannten pflanzlichen Pluspunkten zur Versorgung mit Spurenelementen.
Gesunde, hochwertige Fette bzw. Öle, die reich an Omega-3-Fettsäuren sind oder ein günstiges Verhältnis von Omega-3- zu Omega-6-Fettsäuren beinhalten, Bio-Apfelessig, Saaten wie Chia- und Leinsamen,
Haferkleie und chlorophyllreiche Nahrungsmittel (grünes Blattgemüse oder pulverisierte Formen von Blattgrün, z. B. Löwenzahn- u. Gerstengraspulver, Matcha u. a.) sowie eine drastische Einschränkung
von Zucker sind einige weitere Bestandteile meines Speiseplanes.
Hinzu kommt i. d. R. selbstgeackenes Brot aus Vollkornmehlen, Körnern, Saaten und Kleien unter Verzicht auf Weizenprodukte.
Neben Soja dient mir Fisch als Eiweißlieferant, zur Versorgung mit den Vitaminen E und B 12 und als Quelle von ungesättigten Fettsäuren wie Omega-3-Fettsäuren.
Auf gehärtete Fette versuche ich weitgehend zu verzichten.
Des Weiteren nehme ich häufig Mandeln zu mir, welche als einzige Nüsse (Botanisch zählt die Mandel zu den Steinobstgewächsen.) den Ernährungshaushalt basisch beeinflussen.
Eine insgesamt basisch orientierte Ernährung, die dennoch ausgewogen ist, gilt als gesund und dient mir als Orientierung bei der Zusammenstellung meines Essens.
M. E. n. gehören diese wenigen Tipps in jede medizinische Praxis, allerdings modifiziert in Abstimmung mit individuellen Krankheitsbildern. Jeder Mensch ist anders.
Maren Rehder, 24.01.2016
Ergänzung: Umweltgifte bzw. Chemikalien können das Immunsystem schädigen, so dass sich diverse Krankheitserreger des menschlichen Körpers bemächtigen können. Die Symptome sind
oft vielfältig. Bei einigen Betroffenen mag eine besondere Neigung zu bestimmten Hauterkrankungen auffallen wie Herpes, Akne oder Pilzbefall, die sich auch im Körperinneren
ausbreiten können. Ein ursachenorientierter, ganzheitlicher Behandlungsansatz steht m. E. n. nicht im Widerspruch zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und damit zur Schulmedizin!
Patient(inn)en, die von komplexen Krankheitsbildern betroffen sind, werden von der sog. Schulmedizin aber oftmals "links liegengelassen", wenn sie Kassenpatient(inn)en sind, da sie im
Rahmen einer kassenärztlichen Behandlung die Fallpauschale pro Quartal (d. h. ein mehrmaliges Aufsuchen der Arztpraxis im Quartal von den Erkrankten ist wahrscheinlich) zu überschreiten drohen.
Wenn Mediziner/innen unter rein betriebswirtschaftlichen Aspekten praktizieren, ist die Chance groß, dass Kassenpatient(inn)en mit komplexeren Erkrankungen nur dürftig oder gar nicht
behandelt werden, d. h. sie werden mehr oder weniger abgeschoben - ihr Krankheitsbild wird bagatellisiert. Unter betriebswirtschaftlichen Aspekten sind solche Fälle nicht rentabel genug
für eine Kassenarztpraxis!
In meiner Rettungsschwimmausbildung lernte ich gleich als Erstes den § 323 c des StGB mit dem Sujet "Unterlassene Hilfeleistung" kennen.
Tatsächlich hatte ich mit diesem Paragraphen schon einiges zu tun. So gab es Unfallrisiken und auch Krankheitsfälle am Beckenrand und im Becken selbst oder auch Kinder, die noch nicht
über ausreichende Schwimmfertigkeiten verfügten und aus dem tiefen Wasser gerettet werden mussten.
Als Rettungsschwimmerin sah ich mein Rettungsschwimmabzeichen mit einer gewissen Ehre verknüpft, so dass ich auch privat einschritt, wenn ich einer Notsituation begegnete, in der ich
vielleicht helfen konnte. So unterbrach ich beispielsweise meinen Weg zum Einkaufen, weil ich einmal einen Mann sah, der weinend hinter einem Hund saß, der vor ihm lag. Als ich auf ihn
zutrat, meinte er, dass es nicht sein Hund wäre, und er nicht wüsste, was mit dem Tier los sei. Dann kniete ich mich nieder und versuchte den Herzschlag des Hundes zu spüren.
Leider empfing ich keinerlei Signale, so dass ich davon ausging, dass der Hund tot war. Eine zufällig vorbeikommende Tierärztin bestätigte meinen Eindruck.
Sie gab uns den Hund in einem Müllbeutel mit - eine richtige, ordentliche tierärztliche "Entsorgung" o. ä. des Tieres hätte ansonsten Geld gekostet, was der Mann ablehnte.
Dann gab es noch einen Spritzer gratis Desinfektionsmittel auf die Hände, und der Mann und ich gingen wieder unserer Wege.
Nach meiner zuletzt bestandenen Rettungsschwimmausbildung - am Schluss wird meistens der theoretische Teil mit dem Schreiben eines Tests absolviert - verließ ich mit dem neuen Stempel
im Rettungsschwimmpass gerade das Ausbildungsgebäude einer größeren Hilfsorganisation, als es auf der Straße, die unterhalb meines Weges verlief, mächtig schepperte. Qualm stieg auf,
es roch nach Verbranntem, und ich bekam sofort weiche Knie. "Wie war das noch mit der Ersten Hilfe am Unfallort?" - gerade erst gelernt, aber jetzt in einer so plötzlichen Stresssituation
in leicht vernebelter Erinnerung. Schließlich war ich dicht am Unfallort und sah von einer Brücke auf verbeulte Autos, aus denen nach und nach Menschen krochen oder stiegen.
Naher als ich waren noch andere Passanten am Unfallort gewesen, die z. T. zusammen mit anderen Autoinsaßen einschritten. Ein Rettungssanitäter, der an der Straße wohnte (Welch quälender
Wohnort für einen Menschen mit so einem Beruf!), verließ prompt sein Wohnhaus, und ich fragte ihn zögerlich, ob ich ihm behilflich sein könnte, was dieser jedoch ignorierte. Mittlerweile
waren etliche andere Personen am Ort der Karambolage eingetroffen. Weil ich dann kein Hindernis abgeben wollte, und es offenbar keine schwer verletzten Personen gab, setzte ich etwas erleichtert,
aber auch schockiert darüber, wie schnell so ein Ernstfall eintreffen kann, meinen Weg fort. Einen privatwirtschaftlichen Nutzen schließt dar § 323 c StGB jedenfalls aus!
Ein ärztliches Ethos, das sich allein über die Fallpauschale definiert, lehne ich zutiefst ab! Bei allem Verständnis für betriebswirtschaftliche Erwägungen - die Taschen des "letzten Hemdes"
sind leer, und es wird wohl keinen Arzt und keine Ärztin um die berufliche Existenz bringen, wenn Patient(inn)en, die dringend Hilfe benötigen, eine dementsprechende Behandlung erfahren können!
Ansonsten würde ich von der Ärzteschaft den Mut erwarten, sich ebenso wie Patient(inn)en gegen die sog. Fallpauschale aus humanitären und ethischen Gründen couragiert zu verwahren und ein
anderes Abrechnungssystem einzufordern!
Jedenfalls werde ich Ärzte und Ärztinnen, die in erster Linie auf den Mammon schielen, nicht mehr aufsuchen!
Maren Rehder, 16.04.2016
Nicht nur das Immunsystem kann durch Umweltgifte "irritiert", sondern auch das Nervensystem kann durch z. B. Chlorverbindungen in Mitleidenschaft gezogen werden.
Das Symptombild ist bei einer Nervenschädigung meistens komplex und von vielen ausschließlich linear denkenden Menschen kaum einordbar.
Der Körper sollte grundsätzlich ausreichend mit B-Vitaminen versorgt sein (was auch sonst im Leben anscheinend hilfreich ist:-), da Nerven diese Vitamingruppe benötigen.
In diesem Zusammenhang ist des Weiteren ein kritischer Blick auf die durch die Körperlage im Wasser technisch bedingte Überstreckung der Halswirbelsäule
zu Atmungs- und Orientierungszwecken während des Schwimmens gerichtet.
Der Sport- und Präventionsmediziner Professor Gerd Schnack beurteilt den Schwimmsport von daher als ergonomisch fraglich, rät von Sportarten oder
Dauerbelastungen mit überstreckter Halswirbelsäule prinzipiell ab.
Eine Möglichkeit, die Überstreckung der HWS beim Schwimmen einzudämmen, sieht Professor Schnack im Gebrauch von Taucherbrille und Schnorchel für Schwimmzwecke, um so den Kopf
weitgehend in seiner natürlichen Verlängerung der Wirbelsäule zu belassen.
Ansonsten rät der Ehrenpräsident der Deutschen Gesellschaft für Präventivmedizin zu Sportarten, welche die normale Führung der Wirbelsäule beibehalten
und sich zudem noch dämpfend auf den Bewegungsapparat auswirken, wie dieses beim Aquajogging oder bei Bewegungen auf dem Trampolin der Fall ist.
Einseitigkeiten wirken sich jedoch immer negativ aus - d. h. der Wechsel von Anspannung und Entspannung, die Gegenschwungbewegung sind medizinisch angeraten, um den Körper
vor den Folgen von Fehlhaltungen zu schützen.
Da entlang der Halswirbelsäule mächtige Nervenbahnen verlaufen, ist generell Vorsicht geboten, sobald der Kopf abweichend von seiner natürlichen Haltung gehoben wird.
Bislang las ich über diesen Themenkomplex relativ wenig im Bereich des Schwimmsports. Auch Mountainbiking mit tiefem Lenker ist unter diesem Aspekt orthopädisch bedenklich.
Professionelle Trainer/innen und Sportler/innen aus dem Fitness-, Wellness- oder Leichtathletikbereich berücksichtigen diesen Aspekt zumeist - evtl. mag die Unterrepräsentation
dieses Sachverhalts im Schwimmsport mit einer Art "Sinnestäuschung" zusammenhängen - der Hals mag wegen der Wasserlinie, die den restlichen Körper darunter verschwinden lässt,
nicht als überstreckt angesehen werden. Auch mag die überwiegend gelenkschonende und dazu oft beliebte Bewegung im Wasser dieses entscheidende Detail argumentativ überblenden.
Hinzu tritt der generelle Konsens, dass Sportausübung der freien Wahl unterliegt. Um eine Entscheidung frei treffen zu können, sind jedoch transparente Informationen bzw. eine
Aufklärung über Risiken unabdingbar! Nur so können sich Interessierte ein ganzes Bild von einer Sache machen und eine Wahl mündig vornehmen!
Bisher gilt die generelle Auffassung, dass Schwimmen gesund sei und überhaupt Sportausübung pauschal die Gesundheit fördere!
Diese Slogans müssten jedoch individuell modifiziert und für den Laien verständlicher gemacht werden. Professor Schnack hält nur aerobe Traningsbereiche für gesundheitsförderlich!
Der Leistungssport und das private Training ohne Feedback durch eine Gruppe oder eine professionelle Begleitung bergen medizinisch einige Gefahren durch Selbstüberforderung und auch
durch Unwissenheit oder Unbewusstheit. M. a. W.: Der kritische Verstand und das individuelle Empfinden sind mitaufgefordert, ggf. Grenzen zu setzen und sich nicht einem blinden Vertrauen
zu überlassen, um mögliche Gefährdungen vorzeitig zu eliminieren.
Nach meinem Verständnis reichen Worte nicht aus, um die "einfache" und für jede/jeden verstehbare Botschaft für einen gesunden Lebensstil von Präventionsmediziner Professor Schnack
zu beherzigen - siehe und höre dazu hier:

Foto "Echte Zaunwinde": Copyright © 24.06.2005 by Maren Rehder
https://www.youtube.com/watch?v=8VxmaZFms_E
Maren Rehder, 26.06.2016
Desinfektionsmittel wie Chlor können die natürliche Balance der Haut- und Schleimhautflora schädigen, so dass es zu einem gravierenden mikrobiellen Ungleichgewicht mit
Infektionscharakter kommen kann, wenn z. B. bestimmte Mikroorganismen das mikrobielle Haut- und Schleimhautspektrum dominieren.
I. d. R. handelt es sich dabei nicht um klassische Krankheitserreger, die sich exogen des Körpers bemächtigen, sondern um Mikroorganismen, die zum normalen Mikrobiom zählen.
Entscheidend sind die Größe ihres mengenmäßigen Vorkommens im Verhältnis zu den anderen Mikroorganismen sowie ihre Auswirkung auf die Wechselbeziehungen und Symbiosen innerhalb
des mikrobiellen Besiedelungsraums.
So kann es sein, dass selbst Mirkoorganismen, die alle Menschen natürlicherweise in sich tragen, Krankheitswert erlangen können. Infektionen, die daraus resultieren, werden als
endogen bezeichnet. Auch können die Befunde einer Kolonisation oder Invasion entsprechen o. ä.
Laboranalysen, die keine exogenen Krankheitserreger nachweisen, wird oftmals - einseitig betrachtet - kein pathologischer Wert zugeschrieben, selbst dann nicht, wenn das Labor
unaufgefordert ein Antibiogramm o. ä. angibt oder einen Hinweis darauf, dass die Symptome als entscheidend für eine pathogene Einstufung einzuordnen sind.
Auf den Schweizer Arzt Paracelsus, der im 16. Jh. wirkte, gehen die geflügelten Worte zurück, dass allein die Dosis mache, dass etwas kein Gift sei. M. a. W.: Das Maß ist entscheidend,
damit auch das Gute nicht ein Zuviel wird.
Daher gibt es Grenzwerte für die Chloreinträge in öffentlichen Schwimmbädern.
Maren Rehder, 14.07.2016
HURRA, nach sechs (!) Jahren schwimme ich wieder! Diesmal ganz ohne Schwimmbadchemie, nämlich im Meerwasser!
Ein wenig Überwindung kostete es schon, aber das Allerbeste: Es stellten sich keinerlei "Symptome" während oder nach dem Bad ein - eher im Gegenteil, das Salzwasser wirkt heilsam auf die
noch vorhandene Restsymptomatik, die ich - von der Schulmedizin weitgehend verlassen - auf mich selbst gestellt behandele.
Einige medizinische Ausnahmen, i. d. R. unter prominenten Medizinern, gibt es jedoch schon, bei denen ich mich sehr herzlich bedanke!
Maren Rehder, 24.08.2019
PS: Brustschimmen ist aus orthopädischen Gründen vom Bewegungsablauf her nicht zu empfehlen - Kraulen auf dem Rücken oder in Bauchlage wirken sich wesentlich gesünder aus. Des Weiteren ist
noch zu Aquajogging mit aufrechter Wirbelsäule zu raten.